| SoZ -
Sozialistische Zeitung |
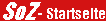 SoZ - Sozialistische Zeitung, Mai 2008, Seite 08
SoZ - Sozialistische Zeitung, Mai 2008, Seite 08
Lip oder die Macht der Fantasie
Ein Lehrbeispiel für Kommunikation und Demokratie
von CHARLES PIAGET
1973 beginnt in der französischen Stadt Besanšon ein soziales Experiment: Weil die Arbeiter der
Uhrenfabrik Lip um ihre Arbeitsplätze fürchten, besetzen sie ihre Fabrik und übernehmen die
Uhrenproduktion in Eigenregie. Zwei Jahre führen sie die Produktion weiter, erproben Konzepte selbst
bestimmter und gleichberechtigter Arbeit und verhindern Entlassungen — bis die Fabrik unter dem Druck
der Konkurrenz endgültig dicht macht. Lip ist das prominenteste Beispiel für das „68 der
Arbeiter” — ihre Entschlossenheit, sich den paternalistisch-autoritären Stil im Betrieb
nicht mehr gefallen zu lassen. Ihr Wahlspruch lautet: „Es ist möglich: wir produzieren, wir
verkaufen, wir bezahlen uns.” Das Beispiel Lip steht bis heute einmalig für eine betriebliche
Kommunikationskultur und eine Form der Interessenvertretung, die dem einzelnen Belegschaftsmitglied die
volle Kontrolle über den eigenen Kampf gibt und dadurch eine unerhörte Schlagkraft bewiesen hat,
ein zukunftsweisendes Modell. Der nachstehende Beitrag ist eine überarbeitete Version einer Bilanz des
Streikführers bei Lip, Charles Piaget, aus dem Jahr 2006.
Als ich 1948 anfing, bei Lip zu arbeiten, schafften dort 1000 Beschäftigte, verstreut über
verschiedene Gebäudeteile, isoliert voneinander. Wir durften unseren Arbeitsplatz ohne Genehmigung
nicht verlassen. Treffen konnten wir uns nur bei Arbeitsbeginn und -ende und in der Pause (10 Minuten am
Morgen). Der Boss, Fred Lip, war ein Patriarch; vor allem in der Nachkriegszeit hingen die Arbeiter und
ihre Familien stark von seinen Wohltaten ab. Nach und nach entließ er alle früheren
Arbeiterführer, die aus der Résistance kamen. Er fertigte seine eigene Belegschaftszeitung und
richtete jeden Freitag nach Feierabend das Wort an die Belegschaft.
 Die Gewerkschaftsvertreter wurden von den
Meistern überwacht. Wer dem Boss nicht passte, flog. Es gab schwarze Listen. Die Arbeiter wurden auch
durch eine besondere Einstellungspolitik unter Druck gesetzt: Im Monat August wurden viele eingestellt, im
Januar viele entlassen. Ein Luxus: in jedem Büro und jeder Werkstatt gab es einen Lautsprecher. So
lernten wir die Bedeutung der Kommunikation kennen.
Die Gewerkschaftsvertreter wurden von den
Meistern überwacht. Wer dem Boss nicht passte, flog. Es gab schwarze Listen. Die Arbeiter wurden auch
durch eine besondere Einstellungspolitik unter Druck gesetzt: Im Monat August wurden viele eingestellt, im
Januar viele entlassen. Ein Luxus: in jedem Büro und jeder Werkstatt gab es einen Lautsprecher. So
lernten wir die Bedeutung der Kommunikation kennen.
 Von den Gewerkschaften gab es die CGT und
die christliche CFTC, ihre Vertreter waren jedoch kaum bekannt, die Strukturen äußerst schwach,
das kollektive Leben der Belegschaft dämmerte vor sich hin. Anfang der 50er Jahre kam ein Schwung
junger Arbeiter in den Betrieb, die das Gewerkschaftsleben neu organisierten.
Von den Gewerkschaften gab es die CGT und
die christliche CFTC, ihre Vertreter waren jedoch kaum bekannt, die Strukturen äußerst schwach,
das kollektive Leben der Belegschaft dämmerte vor sich hin. Anfang der 50er Jahre kam ein Schwung
junger Arbeiter in den Betrieb, die das Gewerkschaftsleben neu organisierten.
 1950 gab es in der Uhrenindustrie in
Besanšon einen zehntägigen Streik um höhere Löhne. Bei Lip wurde er nur von einem Teil der
Belegschaft befolgt, und auch bei ihnen beschränkte er sich darauf, morgens um 10 Uhr zu einer
Streikversammlung geladen zu werden und dann nach Hause zu gehen. Der Streik scheiterte, danach war kein
Mensch mehr zu einer kollektiven Aktion bereit.
1950 gab es in der Uhrenindustrie in
Besanšon einen zehntägigen Streik um höhere Löhne. Bei Lip wurde er nur von einem Teil der
Belegschaft befolgt, und auch bei ihnen beschränkte er sich darauf, morgens um 10 Uhr zu einer
Streikversammlung geladen zu werden und dann nach Hause zu gehen. Der Streik scheiterte, danach war kein
Mensch mehr zu einer kollektiven Aktion bereit.
 Ich arbeitete in der Werkstatt, wo die
Uhrenwerke hergestellt wurden. Die Meister dort waren hoch qualifiziert und sehr individualistisch, sie
wollten ihr Wissen nicht weitergeben, im Gegenteil, eifersüchtig behielten sie ihre Kniffe für
sich. Das Uhrmacherhandwerk ist sehr schwer, die Lehrzeit reicht nicht, um komplexe Gegenstände
herzustellen. Wir jungen Mechaniker fanden einen Ausweg: wir bauten eine regelmäßige
Kommunikation untereinander über Erfolge und Misserfolge bei unserer Arbeit auf. Zu acht schafften wir
es acht mal schneller. So erfuhren wir zum ersten Mal, was Austausch, Solidarität und
Kollektivität bei der Arbeit heißt.
Ich arbeitete in der Werkstatt, wo die
Uhrenwerke hergestellt wurden. Die Meister dort waren hoch qualifiziert und sehr individualistisch, sie
wollten ihr Wissen nicht weitergeben, im Gegenteil, eifersüchtig behielten sie ihre Kniffe für
sich. Das Uhrmacherhandwerk ist sehr schwer, die Lehrzeit reicht nicht, um komplexe Gegenstände
herzustellen. Wir jungen Mechaniker fanden einen Ausweg: wir bauten eine regelmäßige
Kommunikation untereinander über Erfolge und Misserfolge bei unserer Arbeit auf. Zu acht schafften wir
es acht mal schneller. So erfuhren wir zum ersten Mal, was Austausch, Solidarität und
Kollektivität bei der Arbeit heißt.
1953: eine neue Generation
In meiner Werkstatt wurde die Leistungszulage gestrichen. Für die Meister war das ein Pappenstiel,
bei ihren Löhnen fiel das nicht auf. Die Jungen aber setzten sich zur Wehr und traten sofort in den
Streik. Zwei von uns haben die Verhandlungen geführt und die Rücknahme der Streichung
durchgesetzt. Bei den nachfolgenden Gewerkschaftswahlen stellte mich die CFTC auf, weil sie vom Streik Wind
bekommen hatte, und ich wurde gewählt.
 In der CGT und in der CFTC im Betrieb gab
es jetzt eine Reihe von Jüngeren. Wegen der großen Schwächen unserer Gewerkschaften wurden
wir oft vom Personalchef gehänselt. Wir mussten uns eingestehen, dass wir so gut wie keine Verbindung
mit dem Gros der Belegschaft hatten. Beiläufig entdeckten wir, dass der Betriebsrat Arbeiterinnen
gescholten hatte, weil sie sich weigerten, samstags Überstunden zu machen. Er schrieb sogar an den
Boss: „Geben Sie uns nicht mehr Geld, wir haben das vom letzten Jahr noch nicht ausgegeben.”
Dabei waren die Arbeitsbedingungen unerträglich, der Lärm, der Schmutz, der Befehlston, die
ständige Überwachung, das Verbot sich zu unterhalten, die Arbeitsunfälle.
In der CGT und in der CFTC im Betrieb gab
es jetzt eine Reihe von Jüngeren. Wegen der großen Schwächen unserer Gewerkschaften wurden
wir oft vom Personalchef gehänselt. Wir mussten uns eingestehen, dass wir so gut wie keine Verbindung
mit dem Gros der Belegschaft hatten. Beiläufig entdeckten wir, dass der Betriebsrat Arbeiterinnen
gescholten hatte, weil sie sich weigerten, samstags Überstunden zu machen. Er schrieb sogar an den
Boss: „Geben Sie uns nicht mehr Geld, wir haben das vom letzten Jahr noch nicht ausgegeben.”
Dabei waren die Arbeitsbedingungen unerträglich, der Lärm, der Schmutz, der Befehlston, die
ständige Überwachung, das Verbot sich zu unterhalten, die Arbeitsunfälle.
 Die jungen Vertreter in beiden
Gewerkschaften fingen an, sich Fragen zu stellen. Wie konnten wir eine bessere Kommunikation im Betrieb
herstellen? Wie konnten wir in Erfahrung bringen, was in anderen Werkstätten und Büros lief? Wir
lernten unseren Betrieb besser kennen und wurden dadurch auch bekannter; unsere Flugblätter wurden
besser. Schließlich haben wir angefangen, einmal im Monat die Delegierten aus den verschiedensten
Teilen des Betriebs im Gewerkschaftsbüro zusammenzurufen. Mit den Jungen von der CGT arbeiteten wir
dabei eng zusammen, sie stellten sich dieselbe Frage wie wir: Wie können wir die Notwendigkeit
kollektiver Aktionen glaubwürdig vermitteln? Wir haben praktisch alle diese Treffen gemeinsam
organisiert, so haben wir uns kennen gelernt und den Grundstock für unsere Einheit gelegt. Wir
vertrauten uns; das Vertrauen hat noch zugenommen, als mehrere von uns später der Union de la Gauche
Socialiste beigetreten sind, einer Vorläuferorganisation der PSU (Parti Socialiste Unifié).
Die jungen Vertreter in beiden
Gewerkschaften fingen an, sich Fragen zu stellen. Wie konnten wir eine bessere Kommunikation im Betrieb
herstellen? Wie konnten wir in Erfahrung bringen, was in anderen Werkstätten und Büros lief? Wir
lernten unseren Betrieb besser kennen und wurden dadurch auch bekannter; unsere Flugblätter wurden
besser. Schließlich haben wir angefangen, einmal im Monat die Delegierten aus den verschiedensten
Teilen des Betriebs im Gewerkschaftsbüro zusammenzurufen. Mit den Jungen von der CGT arbeiteten wir
dabei eng zusammen, sie stellten sich dieselbe Frage wie wir: Wie können wir die Notwendigkeit
kollektiver Aktionen glaubwürdig vermitteln? Wir haben praktisch alle diese Treffen gemeinsam
organisiert, so haben wir uns kennen gelernt und den Grundstock für unsere Einheit gelegt. Wir
vertrauten uns; das Vertrauen hat noch zugenommen, als mehrere von uns später der Union de la Gauche
Socialiste beigetreten sind, einer Vorläuferorganisation der PSU (Parti Socialiste Unifié).
Die Kraft des Kollektivs entdecken
Unser erster Erfolg war, als wir entdeckten, dass eine Leistungszulage bei der Berechnung der
Überstunden nicht berücksichtigt worden war. Wir informierten uns über die Rechtslage,
veröffentlichten den Rechtsbruch durch ein Flugblatt, beriefen uns auf Gerichtsurteile und riefen die
Gewerbeaufsicht zu Hilfe. Fred Lip musste kapitulieren; das war ein Paukenschlag, denn wir hatten
Nachforderungen von einem ganzen Jahr, das war ein schöner Batzen Geld. Allmählich zeigte sich,
dass sich kollektiver Widerstand bezahlt macht.
 Wir stellten das Lohngeheimnis in Frage.
Über den Lohnstreifen wurde nicht geredet, das war tabu. Jeder wähnte sich etwas privilegiert.
Bis einige damit einverstanden waren, dass ihr Streifen ohne Namensangabe veröffentlicht wurde. Das
war ein Aufruhr! Die Chefs wurden herbei zitiert und die Geschäftsleitung musste etwas Ordnung in die
Lohnpolitik bringen, Mindest- und Höchstgrenzen festlegen. Das war der Beginn der Lohnstufen und der
Einführung von Transparenz. Den Arbeitern ging Klarheit jetzt vor Geheimnistuerei.
Wir stellten das Lohngeheimnis in Frage.
Über den Lohnstreifen wurde nicht geredet, das war tabu. Jeder wähnte sich etwas privilegiert.
Bis einige damit einverstanden waren, dass ihr Streifen ohne Namensangabe veröffentlicht wurde. Das
war ein Aufruhr! Die Chefs wurden herbei zitiert und die Geschäftsleitung musste etwas Ordnung in die
Lohnpolitik bringen, Mindest- und Höchstgrenzen festlegen. Das war der Beginn der Lohnstufen und der
Einführung von Transparenz. Den Arbeitern ging Klarheit jetzt vor Geheimnistuerei.
 Noch später mischten wir uns in die
Personalpolitik ein. Die Produktionsleiter wurden stark unter Druck gesetzt, länger als zwei Jahre
hielten sie es in der Regel bei Lip nicht aus. Als einer von ihnen wieder einmal entlassen werden sollte,
legte eine Abteilung die Arbeit nieder. Wir wurden aufgefordert, dazu was zu sagen. Wir schlossen uns dem
Streik an, thematisierten aber alle Entlassungen, nicht nur die eine dieses Direktors. Es gab einen
Kompromiss.
Noch später mischten wir uns in die
Personalpolitik ein. Die Produktionsleiter wurden stark unter Druck gesetzt, länger als zwei Jahre
hielten sie es in der Regel bei Lip nicht aus. Als einer von ihnen wieder einmal entlassen werden sollte,
legte eine Abteilung die Arbeit nieder. Wir wurden aufgefordert, dazu was zu sagen. Wir schlossen uns dem
Streik an, thematisierten aber alle Entlassungen, nicht nur die eine dieses Direktors. Es gab einen
Kompromiss.
Staatsstreich 1958
De Gaulle putschte und übte eine diktatorische Macht aus, die keinen Widerspruch duldete. Die
Unternehmer beeilten sich, seinen Führungsstil nachzuahmen. 1959 verloren wir einen Lohnstreik, doch
ohne große Lohneinbußen.
 Wir holten uns einen Wirtschaftsprüfer
und studierten die regionale, die schweizerische und die weltweite Uhrenindustrie. Wir begannen, uns
für Wirtschaftsfragen zu interessieren, an dem Punkt war die CGT zurückhaltender. Wir setzten
auch durch, dass die Gewerkschaftswahlen einmal im Jahr stattfanden, so bekamen wir ein getreueres Abbild
von der Belegschaft.
Wir holten uns einen Wirtschaftsprüfer
und studierten die regionale, die schweizerische und die weltweite Uhrenindustrie. Wir begannen, uns
für Wirtschaftsfragen zu interessieren, an dem Punkt war die CGT zurückhaltender. Wir setzten
auch durch, dass die Gewerkschaftswahlen einmal im Jahr stattfanden, so bekamen wir ein getreueres Abbild
von der Belegschaft.
 1960 entstand in Palente ein neues Werk,
mit zwei großen, untereinander verbundenen Gebäuden. Wir besorgten uns einen detaillierten Plan
vom Werk und begannen, die Fabrik systematisch mit einem Netz von Korrespondenten zu überziehen.
1960 entstand in Palente ein neues Werk,
mit zwei großen, untereinander verbundenen Gebäuden. Wir besorgten uns einen detaillierten Plan
vom Werk und begannen, die Fabrik systematisch mit einem Netz von Korrespondenten zu überziehen.
 1964 wurde aus der CFTC die CFDT. Wir
trafen uns in regelmäßigen Abständen nach der Arbeit bei dem einen oder dem anderen, um
grundlegendere Fragen durchzugehen. Die Hauptfrage war dabei immer wieder: Wie können wir die
Kommunikation mit allen Beschäftigten verbessern?
1964 wurde aus der CFTC die CFDT. Wir
trafen uns in regelmäßigen Abständen nach der Arbeit bei dem einen oder dem anderen, um
grundlegendere Fragen durchzugehen. Die Hauptfrage war dabei immer wieder: Wie können wir die
Kommunikation mit allen Beschäftigten verbessern?
 Ohne uns dessen bewusst zu werden, wurden
wir allmählich zu einer ziemlich untypischen Gewerkschaftsgliederung: Wir befolgten nicht die Order
unserer Gewerkschaft und dachten mit unserem eigenen Kopf. Wir wurden politische aktiv, z.B. protestierten
wir gegen einen Empfang für den NATO-Generalstabschef; ich folgte auch, mit der CGT zusammen, einer
Einladung in die UdSSR, obwohl mein Gewerkschaftsvorsitzender am Ort dagegen war...
Ohne uns dessen bewusst zu werden, wurden
wir allmählich zu einer ziemlich untypischen Gewerkschaftsgliederung: Wir befolgten nicht die Order
unserer Gewerkschaft und dachten mit unserem eigenen Kopf. Wir wurden politische aktiv, z.B. protestierten
wir gegen einen Empfang für den NATO-Generalstabschef; ich folgte auch, mit der CGT zusammen, einer
Einladung in die UdSSR, obwohl mein Gewerkschaftsvorsitzender am Ort dagegen war...
1968: der erste Werksstreik
68 war für uns ein großartiger Moment des demokratischen Kampfes. Wir von der CFDT bereiteten
den Streik sorgfältig und zusammen mit der CGT vor, es herrschte volle Übereinstimmung. Am 20.Mai
wurden die Eingänge zu den wichtigsten Betrieben in Besanšon von Gewerkschaftsgruppen blockiert; das
war der Streik. Die Lip-Beschäftigten forderten wir auf, sich um 8 Uhr morgens in der Kantine
einzufinden, um gemeinsam über die Lage der Nation zu reden. Um 8 Uhr sprachen zwei Redner zur Sache,
dann ging das Mikro rum... Niemand wollte das Wort ergreifen. Die Leitenden sind auch dabei, niemand traut
sich. Zum Glück hatten wir das einkalkuliert, wir verkünden eine Pause, Diskussion in
Kleingruppen, danach soll es eine Abstimmung geben. Das war ein voller Erfolg. Vor der Abstimmung stellten
wir klar, dass die Meinung derer, die sich enthalten wollten oder ein Minderheitenvotum abgaben,
respektiert werden müsse. Eine große Mehrheit stimmte für den Streik. Niemand buhte die
Gegner aus.
 Sofort wurde ein Streikkomitee mit
Delegierten aus jeder Abteilung aufgebaut, gleich ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht, nur das Vertrauen
zählte. Aus anderen Betrieben kamen Delegationen zu uns und staunten darüber, was wir machten.
Unser Vorgehen traf auf vollständiges Unverständnis. Für die Besetzung des Betriebs gab es
klare Regeln: Die Geschäftsleitung durfte bleiben, sofern sie sich in einer begrenzten Zone aufhielt
und nichts gegen den Streik unternahm. Über den Gebrauch der Maschinen bestimmten wir, auch über
die Verwendung des vorrätigen Papiers.
Sofort wurde ein Streikkomitee mit
Delegierten aus jeder Abteilung aufgebaut, gleich ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht, nur das Vertrauen
zählte. Aus anderen Betrieben kamen Delegationen zu uns und staunten darüber, was wir machten.
Unser Vorgehen traf auf vollständiges Unverständnis. Für die Besetzung des Betriebs gab es
klare Regeln: Die Geschäftsleitung durfte bleiben, sofern sie sich in einer begrenzten Zone aufhielt
und nichts gegen den Streik unternahm. Über den Gebrauch der Maschinen bestimmten wir, auch über
die Verwendung des vorrätigen Papiers.
 Fred Lip rastete mehrmals aus. Er trug
ständig eine automatische Pistole bei sich. Jeder Zwischenfall wurde entschlossen vom Streikkomitee
geregelt; das haben einige Vertreter der CFDT schwer verdaut.
Fred Lip rastete mehrmals aus. Er trug
ständig eine automatische Pistole bei sich. Jeder Zwischenfall wurde entschlossen vom Streikkomitee
geregelt; das haben einige Vertreter der CFDT schwer verdaut.
 Es ist uns nicht gelungen, den Betrieb
für die Studenten oder für andere zu öffnen. Die Stimmung war nicht danach und es
überwog die Furcht. Aber wir lernten uns besser kennen, und das vergisst man nicht. Fred Lip hat sehr
schnell ein Abkommen unterzeichnet, aber wir haben gesagt: „Das tritt erst in Kraft, wenn der
Konflikt auf nationaler Ebene vorbei ist."
Es ist uns nicht gelungen, den Betrieb
für die Studenten oder für andere zu öffnen. Die Stimmung war nicht danach und es
überwog die Furcht. Aber wir lernten uns besser kennen, und das vergisst man nicht. Fred Lip hat sehr
schnell ein Abkommen unterzeichnet, aber wir haben gesagt: „Das tritt erst in Kraft, wenn der
Konflikt auf nationaler Ebene vorbei ist."
 Wir konnten die Freiheit der Information
durchsetzen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Arbeiter konnten sich Beschäftigte jetzt im Betrieb
auf einer Informationstafel frei äußern. Diese Tafel sollte sich in den folgenden Jahren als ein
erstrangiges Instrument erweisen. So wie der Arbeitsablauf organisiert war, hatten die Beschäftigten
nicht mehr als zwei Minuten abends und morgens, um unsere Informationen zu lesen. Wir schrieben in
Großbuchstaben; die Tafel war ständig umlagert, die Macht der Arbeiter formierte sich. In der
Stadt interessierten sich leider nur wenige für dieses Kampfmittel.
Wir konnten die Freiheit der Information
durchsetzen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Arbeiter konnten sich Beschäftigte jetzt im Betrieb
auf einer Informationstafel frei äußern. Diese Tafel sollte sich in den folgenden Jahren als ein
erstrangiges Instrument erweisen. So wie der Arbeitsablauf organisiert war, hatten die Beschäftigten
nicht mehr als zwei Minuten abends und morgens, um unsere Informationen zu lesen. Wir schrieben in
Großbuchstaben; die Tafel war ständig umlagert, die Macht der Arbeiter formierte sich. In der
Stadt interessierten sich leider nur wenige für dieses Kampfmittel.
 Außerdem bekamen wir einmal im Quartal
eineinhalb Stunden, um die gesamte Belegschaft zu informieren, was wir voll nutzten. Die Infotafel war Fred
Lip ein Dorn im Auge. Eines Tages hat er den Personalleiter geschickt, ein Plakat abzureißen. Wir
ließen uns das von einem Gesetzesvertreter des bestätigen und machten es, mitsamt dem Gesetz, das
gebrochen worden war, öffentlich... Fred Lip wagte das nie wieder.
Außerdem bekamen wir einmal im Quartal
eineinhalb Stunden, um die gesamte Belegschaft zu informieren, was wir voll nutzten. Die Infotafel war Fred
Lip ein Dorn im Auge. Eines Tages hat er den Personalleiter geschickt, ein Plakat abzureißen. Wir
ließen uns das von einem Gesetzesvertreter des bestätigen und machten es, mitsamt dem Gesetz, das
gebrochen worden war, öffentlich... Fred Lip wagte das nie wieder.
 Unsere kurze Erfahrung freier Rede und
kollektiver Debatte, reichte aus, dass die Beschäftigten gewisse Arbeitsbedingungen nicht mehr
hinnahmen. Überall im Betrieb brachen kleine Konflikte aus, die Arbeiter wollten respektiert und
gerecht behandelt werden. Die Gewerbeaufsicht forderte uns auf, all diese Konflikte sofort zu beenden. Das
lehnten wir ab: „Das entscheiden die Werkstätten und Büros allein.” Wenn irgendwo ein
Konflikt war, gingen zwei Gewerkschaftsvertreter hin, es gab eine gemeinsame Diskussion mit der gesamten
Werkstatt, die Beschäftigten entwickelten ihre Forderungen, die Gewerkschaftsvertreter brachten
zusätzliche Informationen ein. Wenn es Verhandlungen geben sollte, wurde darüber gesprochen, was
und wie verhandelt werden sollte, eine Verhandlungsdelegation wurde gewählt, begleitet von den zwei
Gewerkschaftsvertretern. Das Ergebnis wurde dann wieder von der Versammlung der Werkstatt begutachtet. Es
gab etwa 15 solcher Konflikte.
Unsere kurze Erfahrung freier Rede und
kollektiver Debatte, reichte aus, dass die Beschäftigten gewisse Arbeitsbedingungen nicht mehr
hinnahmen. Überall im Betrieb brachen kleine Konflikte aus, die Arbeiter wollten respektiert und
gerecht behandelt werden. Die Gewerbeaufsicht forderte uns auf, all diese Konflikte sofort zu beenden. Das
lehnten wir ab: „Das entscheiden die Werkstätten und Büros allein.” Wenn irgendwo ein
Konflikt war, gingen zwei Gewerkschaftsvertreter hin, es gab eine gemeinsame Diskussion mit der gesamten
Werkstatt, die Beschäftigten entwickelten ihre Forderungen, die Gewerkschaftsvertreter brachten
zusätzliche Informationen ein. Wenn es Verhandlungen geben sollte, wurde darüber gesprochen, was
und wie verhandelt werden sollte, eine Verhandlungsdelegation wurde gewählt, begleitet von den zwei
Gewerkschaftsvertretern. Das Ergebnis wurde dann wieder von der Versammlung der Werkstatt begutachtet. Es
gab etwa 15 solcher Konflikte.
1969: Werksblockade
Fred Lip kündigte das Abkommen von Mai 68, fror trotz starker Inflation die Löhne ein und
drohte mit Werkstilllegung. Einige bekommen Angst, eine Minderheit will den Betrieb sofort besetzen. Zum
Glück erinnern einige an die Regeln, die wir uns gegeben haben: Eine Minderheitenaktion würde der
Belegschaft sehr schaden, also müssen wir eine für alle akzeptable Lösung finden. Es
entsteht der Vorschlag, eine Schlange zu bilden und durch den Betrieb zu ziehen. Wenn die Schlange durch
ihre Werkstatt kommt, scheren diejenigen, die für den Streik sind, aus und reden mit ihren Kollegen.
Nach der Diskussion bekommt die Schlange manchmal Zulauf, es gibt Beifall und man zieht weiter. Nach drei
Tagen gibt es eine deutliche Mehrheit für den Streik. Aber es ist Juni und bald beginnen die Ferien.
 Dann sagen einige: „Wir müssen
die Auslieferung blockieren. Um diese Zeit werden die meisten Uhren verkauft.” 30 Arbeiter riegeln
die Auslieferung ab. Fred Lip sucht die Kraftprobe, sammelt ein paar leitende Angestellte und will die
Auslieferung erzwingen. Ein Moment höchster Gefahr. Eine Gruppe Gewerkschaftsvertreter geht
dazwischen. Langsam zieht sich die Gruppe um den Boss zurück. Fred Lip versteht: Diese Belegschaft
steht zusammen.
Dann sagen einige: „Wir müssen
die Auslieferung blockieren. Um diese Zeit werden die meisten Uhren verkauft.” 30 Arbeiter riegeln
die Auslieferung ab. Fred Lip sucht die Kraftprobe, sammelt ein paar leitende Angestellte und will die
Auslieferung erzwingen. Ein Moment höchster Gefahr. Eine Gruppe Gewerkschaftsvertreter geht
dazwischen. Langsam zieht sich die Gruppe um den Boss zurück. Fred Lip versteht: Diese Belegschaft
steht zusammen.
1970/71: Übernahme
1970 übernimmt die schweizerische Ebauches SA 43% der Aktien von Lip.
 Fred Lip erarbeitet einen
Umstrukturierungsplan. Die beiden Werkstätten, in denen die kämpferischsten
Belegschaftsmitglieder arbeiten, werden gestrichen. Ein langer Kampf beginnt, jedoch ohne Streik. Statt
dessen herrscht allgemeiner Ungehorsam im gesamten Betrieb.
Fred Lip erarbeitet einen
Umstrukturierungsplan. Die beiden Werkstätten, in denen die kämpferischsten
Belegschaftsmitglieder arbeiten, werden gestrichen. Ein langer Kampf beginnt, jedoch ohne Streik. Statt
dessen herrscht allgemeiner Ungehorsam im gesamten Betrieb.
 Wir nutzen dazu Ministerpräsident
Chaban-Delmas‘ neues Gesetz über die Betriebsräte: im Betrieb dürfen keine
Veränderungen ohne vorherige Konsultation des Betriebsrats vorgenommen werden. Fred Lip setzt sich
jedoch darüber hinweg. Wir sind nun die, die das Gesetz verteidigen und machen die Sache überall
bekannt. Kein Streik, aber beim Zeichen eines der Gewerkschaftsvertreter blockieren alle Mechaniker den
befohlenen Abtransport der Maschinen; der Betriebsrat rügt die Geschäftsleitung. Die anderen
Werkstätten und Büros solidarisieren sich. Der Plan wird fallen gelassen, Fred Lip wird von
seinem Vorstandsposten entfernt.
Wir nutzen dazu Ministerpräsident
Chaban-Delmas‘ neues Gesetz über die Betriebsräte: im Betrieb dürfen keine
Veränderungen ohne vorherige Konsultation des Betriebsrats vorgenommen werden. Fred Lip setzt sich
jedoch darüber hinweg. Wir sind nun die, die das Gesetz verteidigen und machen die Sache überall
bekannt. Kein Streik, aber beim Zeichen eines der Gewerkschaftsvertreter blockieren alle Mechaniker den
befohlenen Abtransport der Maschinen; der Betriebsrat rügt die Geschäftsleitung. Die anderen
Werkstätten und Büros solidarisieren sich. Der Plan wird fallen gelassen, Fred Lip wird von
seinem Vorstandsposten entfernt.
1973: Das Werk in Eigenregie
Am 12.Juni erfährt die Belegschaft, dass Ebauches SA von Lip nur noch den Markennamen, das
Vertriebsnetz und die Uhrenmontage erhalten will. Alles andere soll abgeschafft werden. Das ist ein Plan,
die Gewerkschaften bei Lip zu schleifen. Die Unternehmensleitung legt eine sehr schlechte Bilanz vor und
kündigt Entlassungen und Lohnkürzungen an. Der Betrieb wird sofort besetzt. In der Nacht werden
die fertigen Uhren und das Produktionsmaterial beschlagnahmt.
 Bei Lip beginnt nun der Kampf gegen die
Schicksalsergebenheit, welche die Bilanz verbreitet. Nach einem Klausurwochenende legen die
Gewerkschaftsdelegierten einen Plan für die Gegenwehr vor. Je zwei Delegierte von jeder Abteilung
ziehen durch alle Werkstätten und Büros, am Nachmittag gibt es gemeinsame Debatte. Jemand macht
den Vorschlag für einen Generalstreik; nach weiterer Debatte wird er fallen gelassen zugunsten des
Vorschlags, das Arbeitstempo zu reduzieren, damit mehr Zeit bleibt für den Kampf.
Bei Lip beginnt nun der Kampf gegen die
Schicksalsergebenheit, welche die Bilanz verbreitet. Nach einem Klausurwochenende legen die
Gewerkschaftsdelegierten einen Plan für die Gegenwehr vor. Je zwei Delegierte von jeder Abteilung
ziehen durch alle Werkstätten und Büros, am Nachmittag gibt es gemeinsame Debatte. Jemand macht
den Vorschlag für einen Generalstreik; nach weiterer Debatte wird er fallen gelassen zugunsten des
Vorschlags, das Arbeitstempo zu reduzieren, damit mehr Zeit bleibt für den Kampf.
 Am 18.Juni beschließt eine
Vollversammlung, die Produktion in Eigenregie wieder aufzunehmen, um einen „Lohn zum
Überleben” zu sichern. Die Losung heißt: „Es ist möglich: wir produzieren, wir
verkaufen, wir bezahlen uns.” Der Beschluss, auf eigene Faust weiter zu produzieren, ist eine Antwort
auf das drohende Ausbleiben der Löhne.
Am 18.Juni beschließt eine
Vollversammlung, die Produktion in Eigenregie wieder aufzunehmen, um einen „Lohn zum
Überleben” zu sichern. Die Losung heißt: „Es ist möglich: wir produzieren, wir
verkaufen, wir bezahlen uns.” Der Beschluss, auf eigene Faust weiter zu produzieren, ist eine Antwort
auf das drohende Ausbleiben der Löhne.
 Einigen CFDT-Mitgliedern geht das Duo
CFDT—CGT nicht weit genug, sie wollen ein Aktionskomitee bilden. Die Vollversammlung wird der Ort, wo
alle Forderungen und die Rahmenbedingungen des Kampfes entschieden werden, wo festgelegt wird, wie Gefahren
umschifft und demokratische Grundregeln eingehalten werden. Es gibt zahlreiche Arbeitsgruppen, die den
gesamten Produktionsbetrieb regeln.
Einigen CFDT-Mitgliedern geht das Duo
CFDT—CGT nicht weit genug, sie wollen ein Aktionskomitee bilden. Die Vollversammlung wird der Ort, wo
alle Forderungen und die Rahmenbedingungen des Kampfes entschieden werden, wo festgelegt wird, wie Gefahren
umschifft und demokratische Grundregeln eingehalten werden. Es gibt zahlreiche Arbeitsgruppen, die den
gesamten Produktionsbetrieb regeln.
 Die Lage hat sich nun vollständig
geändert: Jetzt sind alle Versammlungen öffentlich, die Presse ist immer dabei. Einige
Journalisten schlafen im Betrieb. So ist der Kampf sehr bekannt geworden. Die Unterstützung von
außen war enorm.
Die Lage hat sich nun vollständig
geändert: Jetzt sind alle Versammlungen öffentlich, die Presse ist immer dabei. Einige
Journalisten schlafen im Betrieb. So ist der Kampf sehr bekannt geworden. Die Unterstützung von
außen war enorm.
 Lip wurde nun zu einem ständigen
Forum, und immer mehr Beschäftigte wurden in die allgemeine Dimension ihres Kampfes hineingezogen. 60
Belegschaftsmitglieder begleiteten immer die Verhandlungskommission, egal wohin. Und immer mehr
Beschäftigte mussten nach draußen, durch die Lande, um den Konflikt zu erklären. Arbeiter
wurden so zu politischen Aktivisten; vor allem die Frauen sind hier hervorgetreten.
Lip wurde nun zu einem ständigen
Forum, und immer mehr Beschäftigte wurden in die allgemeine Dimension ihres Kampfes hineingezogen. 60
Belegschaftsmitglieder begleiteten immer die Verhandlungskommission, egal wohin. Und immer mehr
Beschäftigte mussten nach draußen, durch die Lande, um den Konflikt zu erklären. Arbeiter
wurden so zu politischen Aktivisten; vor allem die Frauen sind hier hervorgetreten.
 Am 15.August wird der Betrieb von der
Polizei besetzt, die Arbeiter vertrieben. Die Polizei bleibt dort bis zum Februar 1974, bis das PSU-
Mitglied Claude Neuschwander den Betrieb übernimmt. 850 Arbeiter werden wieder eingestellt. Der Streik
ist zu Ende.
Am 15.August wird der Betrieb von der
Polizei besetzt, die Arbeiter vertrieben. Die Polizei bleibt dort bis zum Februar 1974, bis das PSU-
Mitglied Claude Neuschwander den Betrieb übernimmt. 850 Arbeiter werden wieder eingestellt. Der Streik
ist zu Ende.
1974: Das Ende
Der Ölschock und die erste schwere Wirtschaftskrise führen überall zu Massenentlassungen
und zahlreichen Betriebsschließungen. Am 8.Februar 1976 legt Neuschwander wegen zunehmender
wirtschaftlicher und politischer Schwierigkeiten seine Funktion nieder. Er erklärt: „Bis Lip
lebten wir in einem Kapitalismus, in dem das Unternehmen das Herz der Ökonomie bildete. Danach leben
wir in einem Kapitalismus, in dem Finanz und das Geld das Herz der Ökonomie bilden."
 Am 5.Mai 1976 besetzen 620
Beschäftigte erneut die Fabrik und kurbeln die Produktion wieder an. Es gibt verschiedene Projekte,
u.a. die Aufnahme von Lip in einen regionalen Strukturplan; das scheitert am mangelnden politischen Willen.
Am 5.Mai 1976 besetzen 620
Beschäftigte erneut die Fabrik und kurbeln die Produktion wieder an. Es gibt verschiedene Projekte,
u.a. die Aufnahme von Lip in einen regionalen Strukturplan; das scheitert am mangelnden politischen Willen.
 Am 12.September 1977 wird Lip
endgültig liquidiert. Nach langen Debatten werden auf dem Werksgelände verschiedene
Genossenschaften angesiedelt; sieben bleiben davon am Schluss übrig, darunter Les Industries de
Palente (LIP). Sie müssen das Werksgelände Palente jedoch verlassen.
Am 12.September 1977 wird Lip
endgültig liquidiert. Nach langen Debatten werden auf dem Werksgelände verschiedene
Genossenschaften angesiedelt; sieben bleiben davon am Schluss übrig, darunter Les Industries de
Palente (LIP). Sie müssen das Werksgelände Palente jedoch verlassen.
 1990 kauft Jean-Claude Sensemat den
Markennamen und beginnt eine neue Uhrenproduktion auf der Basis von Versandhandel. Firmensitz ist Lectoure
in Südfrankreich. Ein Teil der Fertigung läuft heute in China. (Übersetzung: Angela Klein.)
1990 kauft Jean-Claude Sensemat den
Markennamen und beginnt eine neue Uhrenproduktion auf der Basis von Versandhandel. Firmensitz ist Lectoure
in Südfrankreich. Ein Teil der Fertigung läuft heute in China. (Übersetzung: Angela Klein.)
Ich möchte die SoZ mal in der Hand halten
und bestelle eine kostenlose Probeausgabe oder ein Probeabo
|
|

|
|
Sozialistische Hefte
für Theorie und Praxis
Sonderausgabe der SoZ
42 Seiten, 5 Euro,
|
|
|
Der Stand der Dinge
Perry Anderson überblickt den westpolitischen Stand der Dinge
Gregory Albo untersucht den anhaltenden politischen Erfolg des Neoliberalismus und die Schwäche der Linken
Alfredo Saa-Fidho verdeutlicht die Unterschiede der keynsianischen und der marxistischen Kritik des Neoliberalismus
Ulrich Duchrow fragt nach den psychischen Mechanismen und Kosten des Neoliberlismus
Walter Benn Michaelis sieht in Barack Obama das neue Pin-Up des Neoliberalismus und zeigt, dass es nicht reicht, nur von Vielfalt zu reden
Christoph Jünke über Karl Liebknechts Aktualität
|
|

 Die Gewerkschaftsvertreter wurden von den
Meistern überwacht. Wer dem Boss nicht passte, flog. Es gab schwarze Listen. Die Arbeiter wurden auch
durch eine besondere Einstellungspolitik unter Druck gesetzt: Im Monat August wurden viele eingestellt, im
Januar viele entlassen. Ein Luxus: in jedem Büro und jeder Werkstatt gab es einen Lautsprecher. So
lernten wir die Bedeutung der Kommunikation kennen.
Die Gewerkschaftsvertreter wurden von den
Meistern überwacht. Wer dem Boss nicht passte, flog. Es gab schwarze Listen. Die Arbeiter wurden auch
durch eine besondere Einstellungspolitik unter Druck gesetzt: Im Monat August wurden viele eingestellt, im
Januar viele entlassen. Ein Luxus: in jedem Büro und jeder Werkstatt gab es einen Lautsprecher. So
lernten wir die Bedeutung der Kommunikation kennen.
 Von den Gewerkschaften gab es die CGT und
die christliche CFTC, ihre Vertreter waren jedoch kaum bekannt, die Strukturen äußerst schwach,
das kollektive Leben der Belegschaft dämmerte vor sich hin. Anfang der 50er Jahre kam ein Schwung
junger Arbeiter in den Betrieb, die das Gewerkschaftsleben neu organisierten.
Von den Gewerkschaften gab es die CGT und
die christliche CFTC, ihre Vertreter waren jedoch kaum bekannt, die Strukturen äußerst schwach,
das kollektive Leben der Belegschaft dämmerte vor sich hin. Anfang der 50er Jahre kam ein Schwung
junger Arbeiter in den Betrieb, die das Gewerkschaftsleben neu organisierten.
 1950 gab es in der Uhrenindustrie in
Besanšon einen zehntägigen Streik um höhere Löhne. Bei Lip wurde er nur von einem Teil der
Belegschaft befolgt, und auch bei ihnen beschränkte er sich darauf, morgens um 10 Uhr zu einer
Streikversammlung geladen zu werden und dann nach Hause zu gehen. Der Streik scheiterte, danach war kein
Mensch mehr zu einer kollektiven Aktion bereit.
1950 gab es in der Uhrenindustrie in
Besanšon einen zehntägigen Streik um höhere Löhne. Bei Lip wurde er nur von einem Teil der
Belegschaft befolgt, und auch bei ihnen beschränkte er sich darauf, morgens um 10 Uhr zu einer
Streikversammlung geladen zu werden und dann nach Hause zu gehen. Der Streik scheiterte, danach war kein
Mensch mehr zu einer kollektiven Aktion bereit.
 Ich arbeitete in der Werkstatt, wo die
Uhrenwerke hergestellt wurden. Die Meister dort waren hoch qualifiziert und sehr individualistisch, sie
wollten ihr Wissen nicht weitergeben, im Gegenteil, eifersüchtig behielten sie ihre Kniffe für
sich. Das Uhrmacherhandwerk ist sehr schwer, die Lehrzeit reicht nicht, um komplexe Gegenstände
herzustellen. Wir jungen Mechaniker fanden einen Ausweg: wir bauten eine regelmäßige
Kommunikation untereinander über Erfolge und Misserfolge bei unserer Arbeit auf. Zu acht schafften wir
es acht mal schneller. So erfuhren wir zum ersten Mal, was Austausch, Solidarität und
Kollektivität bei der Arbeit heißt.
Ich arbeitete in der Werkstatt, wo die
Uhrenwerke hergestellt wurden. Die Meister dort waren hoch qualifiziert und sehr individualistisch, sie
wollten ihr Wissen nicht weitergeben, im Gegenteil, eifersüchtig behielten sie ihre Kniffe für
sich. Das Uhrmacherhandwerk ist sehr schwer, die Lehrzeit reicht nicht, um komplexe Gegenstände
herzustellen. Wir jungen Mechaniker fanden einen Ausweg: wir bauten eine regelmäßige
Kommunikation untereinander über Erfolge und Misserfolge bei unserer Arbeit auf. Zu acht schafften wir
es acht mal schneller. So erfuhren wir zum ersten Mal, was Austausch, Solidarität und
Kollektivität bei der Arbeit heißt.
