| SoZ -
Sozialistische Zeitung |
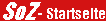 SoZ - Sozialistische Zeitung, Mai 2008, Seite 21
SoZ - Sozialistische Zeitung, Mai 2008, Seite 21
Den „Beiträgen” ist die Bewegung abhanden gekommen
Nach 30 Jahren wurde die älteste Zeitschrift der Frauenbewegung eingestellt
von GISELA NOTZ
Die Zeitschrift Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis wurde am
7.März 2008, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag, und ausgerechnet im Jahr der
vielfältigen Aktivitäten zu „40 Jahre 1968” und zu dem ebenso alten
„Tomatenwurf” der aufmüpfigen Frauen, der schließlich zur Gründung oder
Entdeckung der Frauenbewegung geführt hatte, offiziell eingestellt. Bis zuletzt hatten sie sich selbst
als die größte und älteste Zeitschrift der autonomen Frauenbewegung bezeichnet. 30 Jahre
nach Erscheinen ihrer ersten Ausgabe sind sie klammheimlich von der Bildfläche verschwunden.
 Entstanden waren die Beiträge auf der
Suche nach mehr theoretischer Klarheit in den Frauenbewegungen und aus der Erkenntnis heraus, dass Frauen
gemeinsam mehr erreichen können als einzelne Frauen in Universitäten und anderen Institutionen.
Insgesamt sieben Hefte wurden zwischen 1978 und 1982 in einem Rotationsverfahren von verschiedenen
Redaktionsgruppen im Verlag Frauenoffensive publiziert. 1983 bildete sich eine feste Redaktionsgruppe;
herausgegeben wurden die Beiträge nun durch den bundesweiten „Verein sozialwissenschaftliche
Forschung und Praxis für Frauen” in Köln. Die Beiträge wollten nicht nur feministische
Forschung publizieren, sondern ein breites Diskussionsforum für die zahlreichen, im Zuge der
Frauenbewegungen entstandenen Frauenprojekte schaffen.
Entstanden waren die Beiträge auf der
Suche nach mehr theoretischer Klarheit in den Frauenbewegungen und aus der Erkenntnis heraus, dass Frauen
gemeinsam mehr erreichen können als einzelne Frauen in Universitäten und anderen Institutionen.
Insgesamt sieben Hefte wurden zwischen 1978 und 1982 in einem Rotationsverfahren von verschiedenen
Redaktionsgruppen im Verlag Frauenoffensive publiziert. 1983 bildete sich eine feste Redaktionsgruppe;
herausgegeben wurden die Beiträge nun durch den bundesweiten „Verein sozialwissenschaftliche
Forschung und Praxis für Frauen” in Köln. Die Beiträge wollten nicht nur feministische
Forschung publizieren, sondern ein breites Diskussionsforum für die zahlreichen, im Zuge der
Frauenbewegungen entstandenen Frauenprojekte schaffen.
 Die insgesamt 69 bunten Hefte enthalten ein
breites Spektrum an nationalen und internationalen feministischen Erkenntnissen und Diskussionen. Die
Konzeption der Schwerpunkthefte wurde bis zuletzt beibehalten. Die Themen sind vielfältig, sie
umfassen alles, was Frauen in besonderer Weise betrifft, aus einer feministischen Sicht: Krieg, Arbeit,
Staat, Forschung, Geld, Therapie, Politik, Familie, Fremdenhass, Fundamentalismen, Alter, Gewalt, Utopie,
Globalisierung, Lebensweisen, Kultur, Medien — um nur einige aufzuzählen. Die Beiträge
griffen nicht nur aktuelle Themen auf, sondern initiierten auch Debatten.
Die insgesamt 69 bunten Hefte enthalten ein
breites Spektrum an nationalen und internationalen feministischen Erkenntnissen und Diskussionen. Die
Konzeption der Schwerpunkthefte wurde bis zuletzt beibehalten. Die Themen sind vielfältig, sie
umfassen alles, was Frauen in besonderer Weise betrifft, aus einer feministischen Sicht: Krieg, Arbeit,
Staat, Forschung, Geld, Therapie, Politik, Familie, Fremdenhass, Fundamentalismen, Alter, Gewalt, Utopie,
Globalisierung, Lebensweisen, Kultur, Medien — um nur einige aufzuzählen. Die Beiträge
griffen nicht nur aktuelle Themen auf, sondern initiierten auch Debatten.
 Im Laufe der Jahre haben sich die
Beiträge zu einem anerkannten Forum und Arbeitsmittel entwickelt, das sowohl in den Frauenbewegungen
als auch in der politischen Bildungsarbeit, in gewerkschaftlichen, kirchlichen und anderen
Zusammenhängen sowie an Universitäten vielfältig genutzt wurde. Universitäts- und
Fachhochschulprofessorinnen sowie engagierte Frauen aus dem parlamentarischen und vorparlamentarischen Raum
— z. B. Frauenbeauftragte, Politikerinnen und Gewerkschafterinnen — gehörten zu den
Leserinnen und Autorinnen. Männer abonnierten die Beiträge oder lasen sie regelmäßig.
Große Kongresse und Tagungen, öffentliche Veranstaltungen und Vortragsabende gehen auf ihre
Initiative zurück, wie etwa die Kongresse „Zukunft der Frauenarbeit”, „Frauen gegen
Gen- und Reproduktionstechnologien”, „Frauen gegen Rassismus” u.a.
Im Laufe der Jahre haben sich die
Beiträge zu einem anerkannten Forum und Arbeitsmittel entwickelt, das sowohl in den Frauenbewegungen
als auch in der politischen Bildungsarbeit, in gewerkschaftlichen, kirchlichen und anderen
Zusammenhängen sowie an Universitäten vielfältig genutzt wurde. Universitäts- und
Fachhochschulprofessorinnen sowie engagierte Frauen aus dem parlamentarischen und vorparlamentarischen Raum
— z. B. Frauenbeauftragte, Politikerinnen und Gewerkschafterinnen — gehörten zu den
Leserinnen und Autorinnen. Männer abonnierten die Beiträge oder lasen sie regelmäßig.
Große Kongresse und Tagungen, öffentliche Veranstaltungen und Vortragsabende gehen auf ihre
Initiative zurück, wie etwa die Kongresse „Zukunft der Frauenarbeit”, „Frauen gegen
Gen- und Reproduktionstechnologien”, „Frauen gegen Rassismus” u.a.
 Zum FrauenStreikTag am 8.März 1994
übernahmen die Beiträge eine der beiden bundesweiten Koordinierungsstellen und stellten Kontakte
zu isländischen und schweizerischen Frauen her, die einige Jahre vorher bereits gestreikt hatten. Aus
dem durch den Streiktag erhofften Neuanfang innerhalb der Frauenbewegungen ist leider nichts geworden.
Zum FrauenStreikTag am 8.März 1994
übernahmen die Beiträge eine der beiden bundesweiten Koordinierungsstellen und stellten Kontakte
zu isländischen und schweizerischen Frauen her, die einige Jahre vorher bereits gestreikt hatten. Aus
dem durch den Streiktag erhofften Neuanfang innerhalb der Frauenbewegungen ist leider nichts geworden.
Zwischen den Stühlen
Die Zeitschrift war ein wichtiges Medium zur Vernetzung von Frauenprojekten und -zusammenschlüssen
und ein politisches und theoretisches Diskussionsforum der autonomen Frauenbewegung, soweit diese noch
existiert. Sie versuchte, feministische Theorien an ihrer Praxisfähigkeit zu messen. Während
ihrer Blütezeit war sie fester Bestandteil einer feministischen Gegenöffentlichkeit. Oft
saßen die Beiträge zwischen den Stühlen: Den Wissenschaftlerinnen waren sie zu politisch,
den Praktikerinnen zu abgehoben und theoretisch.
 "Wie der Frauenbewegung die Bewegung
abhanden kam, so verloren die Beiträge mit der Ausdifferenzierung der Gender Studies allmählich
die diskutierlustige Klientel,” schrieb die Taz in ihrer Ausgabe vom 22.Februar 2008. Der Verlag
könne sich nicht mehr tragen, heißt es in einem Schreiben an die Abonnenten: „Die hohen
Produktionskosten stehen nicht mehr im Verhältnis zu den Einnahmen.” Die Auflage der Zeitschrift
ist von 3000 Exemplaren vor zehn Jahren auf 600 gesunken. Zudem sei es für das ehrenamtlich arbeitende
Redaktionsteam „immer schwieriger geworden, Autorinnen zu gewinnen” Schließlich mussten
sie, ebenso wie die Redakteurinnen, Gratisarbeit für das politische Projekt leisten, was angesichts
der oft unsicheren Beschäftigungsverhältnisse der Schreiberinnen nicht immer leicht, oft
unmöglich war. Vom ursprünglichen Kollektiv von 1983 war zuletzt nur noch eine Frau übrig.
Trennungen, auch aufgrund inhaltlicher Kontroversen, waren oft schmerzlich.
"Wie der Frauenbewegung die Bewegung
abhanden kam, so verloren die Beiträge mit der Ausdifferenzierung der Gender Studies allmählich
die diskutierlustige Klientel,” schrieb die Taz in ihrer Ausgabe vom 22.Februar 2008. Der Verlag
könne sich nicht mehr tragen, heißt es in einem Schreiben an die Abonnenten: „Die hohen
Produktionskosten stehen nicht mehr im Verhältnis zu den Einnahmen.” Die Auflage der Zeitschrift
ist von 3000 Exemplaren vor zehn Jahren auf 600 gesunken. Zudem sei es für das ehrenamtlich arbeitende
Redaktionsteam „immer schwieriger geworden, Autorinnen zu gewinnen” Schließlich mussten
sie, ebenso wie die Redakteurinnen, Gratisarbeit für das politische Projekt leisten, was angesichts
der oft unsicheren Beschäftigungsverhältnisse der Schreiberinnen nicht immer leicht, oft
unmöglich war. Vom ursprünglichen Kollektiv von 1983 war zuletzt nur noch eine Frau übrig.
Trennungen, auch aufgrund inhaltlicher Kontroversen, waren oft schmerzlich.
 Eine der Mitbegründerinnen, Brunhilde
Sauer-Burghard, sagte gegenüber der Taz: „Jeder Zweig der Genderforschung hat nun seine eigene
Zeitschrift.” Auf redaktionellen Nachwachs hofft auch Brunhilde Sauer-Burghard nicht: „Die
jungen Frauen sind blind für strukturelle Diskriminierungen.” Sie sieht das Projekt
Beiträge an einem natürlichen Ende: „Die zweite Frauenbewegung ist vorbei. Die dritte
müssen andere machen. Und die werden dafür sicher andere Formen finden."
Eine der Mitbegründerinnen, Brunhilde
Sauer-Burghard, sagte gegenüber der Taz: „Jeder Zweig der Genderforschung hat nun seine eigene
Zeitschrift.” Auf redaktionellen Nachwachs hofft auch Brunhilde Sauer-Burghard nicht: „Die
jungen Frauen sind blind für strukturelle Diskriminierungen.” Sie sieht das Projekt
Beiträge an einem natürlichen Ende: „Die zweite Frauenbewegung ist vorbei. Die dritte
müssen andere machen. Und die werden dafür sicher andere Formen finden."
 Heute scheinen alle Theorien in einen
gesellschaftlichen Konsens integrierbar. Gerade in Zeiten des sozialpolitischen Kahlschlags und der
Ausdifferenzierung der Gender Studies bis zur Beliebigkeit wären die Beiträge geeignet, den
Vereinzelungstendenzen entgegenzuwirken und ein Forum für die Entwicklung politischer
Handlungsstrategien zu bieten. Leider wurde ihr Wirkungskreis in den letzten Jahren stark eingegrenzt, weil
sie immer unsichtbarer wurden. Das früher täglich besetzte Büro war zuletzt oft nicht zu
erreichen. Das verzögerte die Beantwortung von Anfragen und verärgerte Abonnentinnen und
potenzielle Käuferinnen. Auf den Büchertischen bei Tagungen und Kongressen waren die bis zuletzt
qualitativ hochwertigen Beiträge kaum noch zu finden, das beeinträchtigte die Rezeption der
Artikel. Sie hinterlassen nun eine Lücke im ausgedünnten feministischen Blätterwald.
Heute scheinen alle Theorien in einen
gesellschaftlichen Konsens integrierbar. Gerade in Zeiten des sozialpolitischen Kahlschlags und der
Ausdifferenzierung der Gender Studies bis zur Beliebigkeit wären die Beiträge geeignet, den
Vereinzelungstendenzen entgegenzuwirken und ein Forum für die Entwicklung politischer
Handlungsstrategien zu bieten. Leider wurde ihr Wirkungskreis in den letzten Jahren stark eingegrenzt, weil
sie immer unsichtbarer wurden. Das früher täglich besetzte Büro war zuletzt oft nicht zu
erreichen. Das verzögerte die Beantwortung von Anfragen und verärgerte Abonnentinnen und
potenzielle Käuferinnen. Auf den Büchertischen bei Tagungen und Kongressen waren die bis zuletzt
qualitativ hochwertigen Beiträge kaum noch zu finden, das beeinträchtigte die Rezeption der
Artikel. Sie hinterlassen nun eine Lücke im ausgedünnten feministischen Blätterwald.
Die Autorin war von 1985 bis 1997 Redakteurin der Beiträge zur feministischen Theorie und
Praxis.
Ich möchte die SoZ mal in der Hand halten
und bestelle eine kostenlose Probeausgabe oder ein Probeabo
|
|

|
|
Sozialistische Hefte
für Theorie und Praxis
Sonderausgabe der SoZ
42 Seiten, 5 Euro,
|
|
|
Der Stand der Dinge
Perry Anderson überblickt den westpolitischen Stand der Dinge
Gregory Albo untersucht den anhaltenden politischen Erfolg des Neoliberalismus und die Schwäche der Linken
Alfredo Saa-Fidho verdeutlicht die Unterschiede der keynsianischen und der marxistischen Kritik des Neoliberalismus
Ulrich Duchrow fragt nach den psychischen Mechanismen und Kosten des Neoliberlismus
Walter Benn Michaelis sieht in Barack Obama das neue Pin-Up des Neoliberalismus und zeigt, dass es nicht reicht, nur von Vielfalt zu reden
Christoph Jünke über Karl Liebknechts Aktualität
|
|

 Entstanden waren die Beiträge auf der
Suche nach mehr theoretischer Klarheit in den Frauenbewegungen und aus der Erkenntnis heraus, dass Frauen
gemeinsam mehr erreichen können als einzelne Frauen in Universitäten und anderen Institutionen.
Insgesamt sieben Hefte wurden zwischen 1978 und 1982 in einem Rotationsverfahren von verschiedenen
Redaktionsgruppen im Verlag Frauenoffensive publiziert. 1983 bildete sich eine feste Redaktionsgruppe;
herausgegeben wurden die Beiträge nun durch den bundesweiten „Verein sozialwissenschaftliche
Forschung und Praxis für Frauen” in Köln. Die Beiträge wollten nicht nur feministische
Forschung publizieren, sondern ein breites Diskussionsforum für die zahlreichen, im Zuge der
Frauenbewegungen entstandenen Frauenprojekte schaffen.
Entstanden waren die Beiträge auf der
Suche nach mehr theoretischer Klarheit in den Frauenbewegungen und aus der Erkenntnis heraus, dass Frauen
gemeinsam mehr erreichen können als einzelne Frauen in Universitäten und anderen Institutionen.
Insgesamt sieben Hefte wurden zwischen 1978 und 1982 in einem Rotationsverfahren von verschiedenen
Redaktionsgruppen im Verlag Frauenoffensive publiziert. 1983 bildete sich eine feste Redaktionsgruppe;
herausgegeben wurden die Beiträge nun durch den bundesweiten „Verein sozialwissenschaftliche
Forschung und Praxis für Frauen” in Köln. Die Beiträge wollten nicht nur feministische
Forschung publizieren, sondern ein breites Diskussionsforum für die zahlreichen, im Zuge der
Frauenbewegungen entstandenen Frauenprojekte schaffen.
 Die insgesamt 69 bunten Hefte enthalten ein
breites Spektrum an nationalen und internationalen feministischen Erkenntnissen und Diskussionen. Die
Konzeption der Schwerpunkthefte wurde bis zuletzt beibehalten. Die Themen sind vielfältig, sie
umfassen alles, was Frauen in besonderer Weise betrifft, aus einer feministischen Sicht: Krieg, Arbeit,
Staat, Forschung, Geld, Therapie, Politik, Familie, Fremdenhass, Fundamentalismen, Alter, Gewalt, Utopie,
Globalisierung, Lebensweisen, Kultur, Medien — um nur einige aufzuzählen. Die Beiträge
griffen nicht nur aktuelle Themen auf, sondern initiierten auch Debatten.
Die insgesamt 69 bunten Hefte enthalten ein
breites Spektrum an nationalen und internationalen feministischen Erkenntnissen und Diskussionen. Die
Konzeption der Schwerpunkthefte wurde bis zuletzt beibehalten. Die Themen sind vielfältig, sie
umfassen alles, was Frauen in besonderer Weise betrifft, aus einer feministischen Sicht: Krieg, Arbeit,
Staat, Forschung, Geld, Therapie, Politik, Familie, Fremdenhass, Fundamentalismen, Alter, Gewalt, Utopie,
Globalisierung, Lebensweisen, Kultur, Medien — um nur einige aufzuzählen. Die Beiträge
griffen nicht nur aktuelle Themen auf, sondern initiierten auch Debatten.
 Im Laufe der Jahre haben sich die
Beiträge zu einem anerkannten Forum und Arbeitsmittel entwickelt, das sowohl in den Frauenbewegungen
als auch in der politischen Bildungsarbeit, in gewerkschaftlichen, kirchlichen und anderen
Zusammenhängen sowie an Universitäten vielfältig genutzt wurde. Universitäts- und
Fachhochschulprofessorinnen sowie engagierte Frauen aus dem parlamentarischen und vorparlamentarischen Raum
— z. B. Frauenbeauftragte, Politikerinnen und Gewerkschafterinnen — gehörten zu den
Leserinnen und Autorinnen. Männer abonnierten die Beiträge oder lasen sie regelmäßig.
Große Kongresse und Tagungen, öffentliche Veranstaltungen und Vortragsabende gehen auf ihre
Initiative zurück, wie etwa die Kongresse „Zukunft der Frauenarbeit”, „Frauen gegen
Gen- und Reproduktionstechnologien”, „Frauen gegen Rassismus” u.a.
Im Laufe der Jahre haben sich die
Beiträge zu einem anerkannten Forum und Arbeitsmittel entwickelt, das sowohl in den Frauenbewegungen
als auch in der politischen Bildungsarbeit, in gewerkschaftlichen, kirchlichen und anderen
Zusammenhängen sowie an Universitäten vielfältig genutzt wurde. Universitäts- und
Fachhochschulprofessorinnen sowie engagierte Frauen aus dem parlamentarischen und vorparlamentarischen Raum
— z. B. Frauenbeauftragte, Politikerinnen und Gewerkschafterinnen — gehörten zu den
Leserinnen und Autorinnen. Männer abonnierten die Beiträge oder lasen sie regelmäßig.
Große Kongresse und Tagungen, öffentliche Veranstaltungen und Vortragsabende gehen auf ihre
Initiative zurück, wie etwa die Kongresse „Zukunft der Frauenarbeit”, „Frauen gegen
Gen- und Reproduktionstechnologien”, „Frauen gegen Rassismus” u.a.
 Zum FrauenStreikTag am 8.März 1994
übernahmen die Beiträge eine der beiden bundesweiten Koordinierungsstellen und stellten Kontakte
zu isländischen und schweizerischen Frauen her, die einige Jahre vorher bereits gestreikt hatten. Aus
dem durch den Streiktag erhofften Neuanfang innerhalb der Frauenbewegungen ist leider nichts geworden.
Zum FrauenStreikTag am 8.März 1994
übernahmen die Beiträge eine der beiden bundesweiten Koordinierungsstellen und stellten Kontakte
zu isländischen und schweizerischen Frauen her, die einige Jahre vorher bereits gestreikt hatten. Aus
dem durch den Streiktag erhofften Neuanfang innerhalb der Frauenbewegungen ist leider nichts geworden.
