| SoZ -
Sozialistische Zeitung |
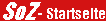 SoZ - Sozialistische Zeitung, Juni 2008, Seite 02
SoZ - Sozialistische Zeitung, Juni 2008, Seite 02
Eine neue Agrarreform
ist fällig
von ANGELA KLEIN
Die Chicago
Mercantile Exchange ist die größte Rohstoff- und Terminbörse der Welt. Hier werden die Preise
für die Rohstoffe der ganzen Welt gemacht. Was hier ausgehandelt wird, bestimmt das Leben von Farmern
im Mittleren Westen der USA, von Reisbauern in Vietnam, von Bäckern in Deutschland.
 Die Broker verwahren sich jedoch gegen die Unterstellung, sie
seien verantwortlich für die Teuerung bei den Lebensmitteln. Sie kaufen und verkaufen „nur”
im Auftrag der Getreidehändler, Plantagenbesitzer und Lebensmittelkonzerne.
Die Broker verwahren sich jedoch gegen die Unterstellung, sie
seien verantwortlich für die Teuerung bei den Lebensmitteln. Sie kaufen und verkaufen „nur”
im Auftrag der Getreidehändler, Plantagenbesitzer und Lebensmittelkonzerne.
 Der Teufel steckt im „nur” Denn
dieses Nur impliziert eine Produktionsordnung für Nahrungsmittel, die es bis vor kurzem in der
Geschichte nicht gegeben hat. Sie zwingt Bauern und Landwirte auf allen Kontinenten, nicht mehr für
ihre Region, sondern für den Weltmarkt zu produzieren. Deshalb werden die Preise für das Brot, das
in Brandenburg verkauft wird, nicht in der Uckermark und auch nicht in Berlin gemacht, sondern in Chicago.
Der Teufel steckt im „nur” Denn
dieses Nur impliziert eine Produktionsordnung für Nahrungsmittel, die es bis vor kurzem in der
Geschichte nicht gegeben hat. Sie zwingt Bauern und Landwirte auf allen Kontinenten, nicht mehr für
ihre Region, sondern für den Weltmarkt zu produzieren. Deshalb werden die Preise für das Brot, das
in Brandenburg verkauft wird, nicht in der Uckermark und auch nicht in Berlin gemacht, sondern in Chicago.
 Im Gegensatz zum lokalen Handel ist der
Fernhandel immer ein hochkonzentrierter und monopolisierter Handel gewesen. Allein die Zulassung an die
Börse setzt eine bestimmte Größe und Kapitalkraft voraus. Der Produzent sieht die Börse
nie, immer nur der Kaufmann.
Im Gegensatz zum lokalen Handel ist der
Fernhandel immer ein hochkonzentrierter und monopolisierter Handel gewesen. Allein die Zulassung an die
Börse setzt eine bestimmte Größe und Kapitalkraft voraus. Der Produzent sieht die Börse
nie, immer nur der Kaufmann.
 Zwischen den Erzeugerpreisen, die der
Landwirt erhält, und den Preisen, die an der Börse gemacht werden, klafft eine riesige Kluft: Vom
Zentner Kaffee, der die Plantage verlässt, leben nicht nur der Kaffeepflanzer und seine Erntehelfer,
nicht nur die Verpackungsindustrie und die Transportgesellschaft, davon leben vor allem die
Handelsgesellschaften, die ihn vermarkten.
Zwischen den Erzeugerpreisen, die der
Landwirt erhält, und den Preisen, die an der Börse gemacht werden, klafft eine riesige Kluft: Vom
Zentner Kaffee, der die Plantage verlässt, leben nicht nur der Kaffeepflanzer und seine Erntehelfer,
nicht nur die Verpackungsindustrie und die Transportgesellschaft, davon leben vor allem die
Handelsgesellschaften, die ihn vermarkten.
 Früher ging es so mit den
„Kolonialwaren”, das waren Luxusgüter. Heute, seit IWF und WTO Freihandelsabkommen und
Strukturanpassungsprogramme durchgesetzt haben, geht es so mit den Grundnahrungsmitteln: Reis, Weizen,
Soja...
Früher ging es so mit den
„Kolonialwaren”, das waren Luxusgüter. Heute, seit IWF und WTO Freihandelsabkommen und
Strukturanpassungsprogramme durchgesetzt haben, geht es so mit den Grundnahrungsmitteln: Reis, Weizen,
Soja...
 Es würde sich lohnen, einmal die
Rechnung aufzumachen, wie viel von dem Geld für ein Pfund Mehl, das wir im Supermarkt kaufen, beim
Erzeuger landet und wie viel beim Zwischenhandel. Der Zwischenhandel (Transportunternehmen ausgenommen) ist
der Parasit an der Stelle: Außer dass er von der Arbeitskraft des Produzenten auf dem Land und des
Konsumenten in der Stadt lebt, trägt er zum Produkt nichts Produktives bei.
Es würde sich lohnen, einmal die
Rechnung aufzumachen, wie viel von dem Geld für ein Pfund Mehl, das wir im Supermarkt kaufen, beim
Erzeuger landet und wie viel beim Zwischenhandel. Der Zwischenhandel (Transportunternehmen ausgenommen) ist
der Parasit an der Stelle: Außer dass er von der Arbeitskraft des Produzenten auf dem Land und des
Konsumenten in der Stadt lebt, trägt er zum Produkt nichts Produktives bei.
 Die Ökonomen sind sich nicht einig
darüber, ob der Preis in Chicago von der Nachfrage oder vom Angebot gesteuert wird. Gegen beide
Theorien kann man etwas einwenden. Die Essgewohnheiten in China haben sich denen der Industrieländer
angeglichen, aber China ist heute ein Nettoexporteur von Nahrungsmitteln.
Die Ökonomen sind sich nicht einig
darüber, ob der Preis in Chicago von der Nachfrage oder vom Angebot gesteuert wird. Gegen beide
Theorien kann man etwas einwenden. Die Essgewohnheiten in China haben sich denen der Industrieländer
angeglichen, aber China ist heute ein Nettoexporteur von Nahrungsmitteln.
 Der Anstieg der Bevölkerung entspannt
sich; die UN-Welternährungsorganisation FAO erwartet, dass sich die Nachfragekurve abflacht — von
einem Plus von 2,2% in den letzten 30 Jahren auf 1,5% in den nächsten Jahren. Die FAO sagt auch, dass
die weltweite Anbaufläche auf 2,8 Milliarden Hektar Land verdoppelt werden könnte, vor allem im
Süden Afrikas und in Lateinamerika. Wir essen unsere Erde noch nicht auf.
Der Anstieg der Bevölkerung entspannt
sich; die UN-Welternährungsorganisation FAO erwartet, dass sich die Nachfragekurve abflacht — von
einem Plus von 2,2% in den letzten 30 Jahren auf 1,5% in den nächsten Jahren. Die FAO sagt auch, dass
die weltweite Anbaufläche auf 2,8 Milliarden Hektar Land verdoppelt werden könnte, vor allem im
Süden Afrikas und in Lateinamerika. Wir essen unsere Erde noch nicht auf.
 Auf der Angebotsseite sieht es etwas anders
aus. Ein Viertel bis ein Drittel der Teuerung geht auf das Konto des Agrosprits, sagt der Generaldirektor
des International Food Research Institute in Washington. 100 Millionen Tonnen Getreide gehen in die Ethanol-
Erzeugung — das entspricht ziemlich genau der Lücke am Weltmarkt, rechnet er vor. 30% der US-
Maisernte landen heute schon im Tank (weltweit sind es 13%); bleibt es bei den Plänen Washingtons,
könnten es bis zum Jahr 2017 100% sein.
Auf der Angebotsseite sieht es etwas anders
aus. Ein Viertel bis ein Drittel der Teuerung geht auf das Konto des Agrosprits, sagt der Generaldirektor
des International Food Research Institute in Washington. 100 Millionen Tonnen Getreide gehen in die Ethanol-
Erzeugung — das entspricht ziemlich genau der Lücke am Weltmarkt, rechnet er vor. 30% der US-
Maisernte landen heute schon im Tank (weltweit sind es 13%); bleibt es bei den Plänen Washingtons,
könnten es bis zum Jahr 2017 100% sein.
 Die EU will den Anteil von Agrosprit bis
2020 von 2% auf 10% heben. Und Kanzlerin Merkel fährt nach Brasilien, um diesen Trend noch zu
unterstützen.
Die EU will den Anteil von Agrosprit bis
2020 von 2% auf 10% heben. Und Kanzlerin Merkel fährt nach Brasilien, um diesen Trend noch zu
unterstützen.
 Diese Art der Angebotsverknappung hat aber
nichts damit zu tun, dass die Erde für uns zu klein würde, oder dass der Klimawandel verhindert,
dass alle Menschen ernährt werden könnten. Noch ist es nicht soweit. Knappheit ist hier
ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass Agrarflächen zweckentfremdet werden, weil die
industrielle Nutzung mehr Profit verspricht. Agrosprit ist dabei nur eine Form der industriellen Nutzung,
eine andere, nicht weniger zerstörerische, ist der Bergbau.
Diese Art der Angebotsverknappung hat aber
nichts damit zu tun, dass die Erde für uns zu klein würde, oder dass der Klimawandel verhindert,
dass alle Menschen ernährt werden könnten. Noch ist es nicht soweit. Knappheit ist hier
ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass Agrarflächen zweckentfremdet werden, weil die
industrielle Nutzung mehr Profit verspricht. Agrosprit ist dabei nur eine Form der industriellen Nutzung,
eine andere, nicht weniger zerstörerische, ist der Bergbau.
 Die Erde hält einen weiteren
Bevölkerungsanstieg ohne weiteres aus. Sie erträgt auch Dürren und Überschwemmungen,
solange sie sich im bisherigen ökologischen Gleichgewicht bewegt. Was sie nicht aushält, ist die
Konzentration von bebaubarem Land in den Händen von Großkonzernen und dessen Ausbeutung nach den
Regeln des schnellen Profits. Das macht die Erde unfruchtbar und treibt die Menschen in Hungersnöte.
Die Erde hält einen weiteren
Bevölkerungsanstieg ohne weiteres aus. Sie erträgt auch Dürren und Überschwemmungen,
solange sie sich im bisherigen ökologischen Gleichgewicht bewegt. Was sie nicht aushält, ist die
Konzentration von bebaubarem Land in den Händen von Großkonzernen und dessen Ausbeutung nach den
Regeln des schnellen Profits. Das macht die Erde unfruchtbar und treibt die Menschen in Hungersnöte.
 Im Konkreten haben die Preise auf dem
Weltmarkt mit den lokalen Anbaubedingungen deshalb herzlich wenig zu tun. „Das Problem in dieser Krise
ist, dass die Weltbank die Subsistenzlandwirtschaft vernachlässigt hat”, erklärt Jean
Ziegler gegenüber der österreichischen Tageszeitung Der Standard (10.5.08).
Im Konkreten haben die Preise auf dem
Weltmarkt mit den lokalen Anbaubedingungen deshalb herzlich wenig zu tun. „Das Problem in dieser Krise
ist, dass die Weltbank die Subsistenzlandwirtschaft vernachlässigt hat”, erklärt Jean
Ziegler gegenüber der österreichischen Tageszeitung Der Standard (10.5.08).
 "Beispiel Mali: Das Land deckt seinen
Reisverbrauch über den Weltmarkt, der Reispreis ist in den vergangenen Monaten um 53% gestiegen, die
Tonne kostet 1000 Dollar. Den Entwicklungsländern wurde die Exportlandwirtschaft aufgezwungen.”
Ziegler weist auch daraufhin, dass die Menschen hungern, weil sie nicht genug Geld haben, Lebensmittel zu
kaufen, und nicht weil es nicht genug davon gäbe.
"Beispiel Mali: Das Land deckt seinen
Reisverbrauch über den Weltmarkt, der Reispreis ist in den vergangenen Monaten um 53% gestiegen, die
Tonne kostet 1000 Dollar. Den Entwicklungsländern wurde die Exportlandwirtschaft aufgezwungen.”
Ziegler weist auch daraufhin, dass die Menschen hungern, weil sie nicht genug Geld haben, Lebensmittel zu
kaufen, und nicht weil es nicht genug davon gäbe.
 Dieser Nahrungsmittelkrise kommt man nur mit
einer Agrarreform bei, die das bebaubare Land wieder in Bauernhand gibt. Dabei kann erstmals erstmals eine
direkte Interessenverbindung zwischen den Armen in den Metropolen und den Armen in den Ländern des
Südens hergestellt werden. Denn dort wie im Norden gibt es jetzt Gegner, die dieselben Namen tragen:
Monsanto, Unilever, Nestlé, Danone, Kraft, aber auch Rio Tinto Zinc u.a. Dort, wo es Industrie gibt,
stehen Arbeiter an der Spitze der Hungerrevolten. Die Forderung nach Mindestlöhnen ist mittlerweile
weltweit zu hören.
Dieser Nahrungsmittelkrise kommt man nur mit
einer Agrarreform bei, die das bebaubare Land wieder in Bauernhand gibt. Dabei kann erstmals erstmals eine
direkte Interessenverbindung zwischen den Armen in den Metropolen und den Armen in den Ländern des
Südens hergestellt werden. Denn dort wie im Norden gibt es jetzt Gegner, die dieselben Namen tragen:
Monsanto, Unilever, Nestlé, Danone, Kraft, aber auch Rio Tinto Zinc u.a. Dort, wo es Industrie gibt,
stehen Arbeiter an der Spitze der Hungerrevolten. Die Forderung nach Mindestlöhnen ist mittlerweile
weltweit zu hören.
 Globale soziale Rechte — das Recht des
Bauern, die örtliche Bevölkerung zu ernähren; das Recht des Arbeiters und Angestellten,
für die Arbeit mindestens einen Lohn zu erhalten, der mit Abstand über der Armutsgrenze liegt; und
das Recht eines jeden Menschen, auch ohne Erwerbsarbeit soviel zum Leben zu haben, dass er nicht unter die
Armutsgrenze fällt — das sind Forderungen, die eine weltweite solidarische Gegenbewegung anfeuern
können.
Globale soziale Rechte — das Recht des
Bauern, die örtliche Bevölkerung zu ernähren; das Recht des Arbeiters und Angestellten,
für die Arbeit mindestens einen Lohn zu erhalten, der mit Abstand über der Armutsgrenze liegt; und
das Recht eines jeden Menschen, auch ohne Erwerbsarbeit soviel zum Leben zu haben, dass er nicht unter die
Armutsgrenze fällt — das sind Forderungen, die eine weltweite solidarische Gegenbewegung anfeuern
können.
Ich möchte die SoZ mal in der Hand halten
und bestelle eine kostenlose Probeausgabe oder ein Probeabo
|
|

|
|
Sozialistische Hefte
für Theorie und Praxis
Sonderausgabe der SoZ
42 Seiten, 5 Euro,
|
|
|
Der Stand der Dinge
Perry Anderson überblickt den westpolitischen Stand der Dinge
Gregory Albo untersucht den anhaltenden politischen Erfolg des Neoliberalismus und die Schwäche der Linken
Alfredo Saa-Fidho verdeutlicht die Unterschiede der keynsianischen und der marxistischen Kritik des Neoliberalismus
Ulrich Duchrow fragt nach den psychischen Mechanismen und Kosten des Neoliberlismus
Walter Benn Michaelis sieht in Barack Obama das neue Pin-Up des Neoliberalismus und zeigt, dass es nicht reicht, nur von Vielfalt zu reden
Christoph Jünke über Karl Liebknechts Aktualität
|
|

 Die Broker verwahren sich jedoch gegen die Unterstellung, sie
seien verantwortlich für die Teuerung bei den Lebensmitteln. Sie kaufen und verkaufen „nur”
im Auftrag der Getreidehändler, Plantagenbesitzer und Lebensmittelkonzerne.
Die Broker verwahren sich jedoch gegen die Unterstellung, sie
seien verantwortlich für die Teuerung bei den Lebensmitteln. Sie kaufen und verkaufen „nur”
im Auftrag der Getreidehändler, Plantagenbesitzer und Lebensmittelkonzerne.
 Der Teufel steckt im „nur” Denn
dieses Nur impliziert eine Produktionsordnung für Nahrungsmittel, die es bis vor kurzem in der
Geschichte nicht gegeben hat. Sie zwingt Bauern und Landwirte auf allen Kontinenten, nicht mehr für
ihre Region, sondern für den Weltmarkt zu produzieren. Deshalb werden die Preise für das Brot, das
in Brandenburg verkauft wird, nicht in der Uckermark und auch nicht in Berlin gemacht, sondern in Chicago.
Der Teufel steckt im „nur” Denn
dieses Nur impliziert eine Produktionsordnung für Nahrungsmittel, die es bis vor kurzem in der
Geschichte nicht gegeben hat. Sie zwingt Bauern und Landwirte auf allen Kontinenten, nicht mehr für
ihre Region, sondern für den Weltmarkt zu produzieren. Deshalb werden die Preise für das Brot, das
in Brandenburg verkauft wird, nicht in der Uckermark und auch nicht in Berlin gemacht, sondern in Chicago.
 Im Gegensatz zum lokalen Handel ist der
Fernhandel immer ein hochkonzentrierter und monopolisierter Handel gewesen. Allein die Zulassung an die
Börse setzt eine bestimmte Größe und Kapitalkraft voraus. Der Produzent sieht die Börse
nie, immer nur der Kaufmann.
Im Gegensatz zum lokalen Handel ist der
Fernhandel immer ein hochkonzentrierter und monopolisierter Handel gewesen. Allein die Zulassung an die
Börse setzt eine bestimmte Größe und Kapitalkraft voraus. Der Produzent sieht die Börse
nie, immer nur der Kaufmann.
 Zwischen den Erzeugerpreisen, die der
Landwirt erhält, und den Preisen, die an der Börse gemacht werden, klafft eine riesige Kluft: Vom
Zentner Kaffee, der die Plantage verlässt, leben nicht nur der Kaffeepflanzer und seine Erntehelfer,
nicht nur die Verpackungsindustrie und die Transportgesellschaft, davon leben vor allem die
Handelsgesellschaften, die ihn vermarkten.
Zwischen den Erzeugerpreisen, die der
Landwirt erhält, und den Preisen, die an der Börse gemacht werden, klafft eine riesige Kluft: Vom
Zentner Kaffee, der die Plantage verlässt, leben nicht nur der Kaffeepflanzer und seine Erntehelfer,
nicht nur die Verpackungsindustrie und die Transportgesellschaft, davon leben vor allem die
Handelsgesellschaften, die ihn vermarkten.
 Früher ging es so mit den
„Kolonialwaren”, das waren Luxusgüter. Heute, seit IWF und WTO Freihandelsabkommen und
Strukturanpassungsprogramme durchgesetzt haben, geht es so mit den Grundnahrungsmitteln: Reis, Weizen,
Soja...
Früher ging es so mit den
„Kolonialwaren”, das waren Luxusgüter. Heute, seit IWF und WTO Freihandelsabkommen und
Strukturanpassungsprogramme durchgesetzt haben, geht es so mit den Grundnahrungsmitteln: Reis, Weizen,
Soja...
 Es würde sich lohnen, einmal die
Rechnung aufzumachen, wie viel von dem Geld für ein Pfund Mehl, das wir im Supermarkt kaufen, beim
Erzeuger landet und wie viel beim Zwischenhandel. Der Zwischenhandel (Transportunternehmen ausgenommen) ist
der Parasit an der Stelle: Außer dass er von der Arbeitskraft des Produzenten auf dem Land und des
Konsumenten in der Stadt lebt, trägt er zum Produkt nichts Produktives bei.
Es würde sich lohnen, einmal die
Rechnung aufzumachen, wie viel von dem Geld für ein Pfund Mehl, das wir im Supermarkt kaufen, beim
Erzeuger landet und wie viel beim Zwischenhandel. Der Zwischenhandel (Transportunternehmen ausgenommen) ist
der Parasit an der Stelle: Außer dass er von der Arbeitskraft des Produzenten auf dem Land und des
Konsumenten in der Stadt lebt, trägt er zum Produkt nichts Produktives bei.
 Die Ökonomen sind sich nicht einig
darüber, ob der Preis in Chicago von der Nachfrage oder vom Angebot gesteuert wird. Gegen beide
Theorien kann man etwas einwenden. Die Essgewohnheiten in China haben sich denen der Industrieländer
angeglichen, aber China ist heute ein Nettoexporteur von Nahrungsmitteln.
Die Ökonomen sind sich nicht einig
darüber, ob der Preis in Chicago von der Nachfrage oder vom Angebot gesteuert wird. Gegen beide
Theorien kann man etwas einwenden. Die Essgewohnheiten in China haben sich denen der Industrieländer
angeglichen, aber China ist heute ein Nettoexporteur von Nahrungsmitteln.
 Der Anstieg der Bevölkerung entspannt
sich; die UN-Welternährungsorganisation FAO erwartet, dass sich die Nachfragekurve abflacht — von
einem Plus von 2,2% in den letzten 30 Jahren auf 1,5% in den nächsten Jahren. Die FAO sagt auch, dass
die weltweite Anbaufläche auf 2,8 Milliarden Hektar Land verdoppelt werden könnte, vor allem im
Süden Afrikas und in Lateinamerika. Wir essen unsere Erde noch nicht auf.
Der Anstieg der Bevölkerung entspannt
sich; die UN-Welternährungsorganisation FAO erwartet, dass sich die Nachfragekurve abflacht — von
einem Plus von 2,2% in den letzten 30 Jahren auf 1,5% in den nächsten Jahren. Die FAO sagt auch, dass
die weltweite Anbaufläche auf 2,8 Milliarden Hektar Land verdoppelt werden könnte, vor allem im
Süden Afrikas und in Lateinamerika. Wir essen unsere Erde noch nicht auf.
 Auf der Angebotsseite sieht es etwas anders
aus. Ein Viertel bis ein Drittel der Teuerung geht auf das Konto des Agrosprits, sagt der Generaldirektor
des International Food Research Institute in Washington. 100 Millionen Tonnen Getreide gehen in die Ethanol-
Erzeugung — das entspricht ziemlich genau der Lücke am Weltmarkt, rechnet er vor. 30% der US-
Maisernte landen heute schon im Tank (weltweit sind es 13%); bleibt es bei den Plänen Washingtons,
könnten es bis zum Jahr 2017 100% sein.
Auf der Angebotsseite sieht es etwas anders
aus. Ein Viertel bis ein Drittel der Teuerung geht auf das Konto des Agrosprits, sagt der Generaldirektor
des International Food Research Institute in Washington. 100 Millionen Tonnen Getreide gehen in die Ethanol-
Erzeugung — das entspricht ziemlich genau der Lücke am Weltmarkt, rechnet er vor. 30% der US-
Maisernte landen heute schon im Tank (weltweit sind es 13%); bleibt es bei den Plänen Washingtons,
könnten es bis zum Jahr 2017 100% sein.
 Die EU will den Anteil von Agrosprit bis
2020 von 2% auf 10% heben. Und Kanzlerin Merkel fährt nach Brasilien, um diesen Trend noch zu
unterstützen.
Die EU will den Anteil von Agrosprit bis
2020 von 2% auf 10% heben. Und Kanzlerin Merkel fährt nach Brasilien, um diesen Trend noch zu
unterstützen.
 Diese Art der Angebotsverknappung hat aber
nichts damit zu tun, dass die Erde für uns zu klein würde, oder dass der Klimawandel verhindert,
dass alle Menschen ernährt werden könnten. Noch ist es nicht soweit. Knappheit ist hier
ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass Agrarflächen zweckentfremdet werden, weil die
industrielle Nutzung mehr Profit verspricht. Agrosprit ist dabei nur eine Form der industriellen Nutzung,
eine andere, nicht weniger zerstörerische, ist der Bergbau.
Diese Art der Angebotsverknappung hat aber
nichts damit zu tun, dass die Erde für uns zu klein würde, oder dass der Klimawandel verhindert,
dass alle Menschen ernährt werden könnten. Noch ist es nicht soweit. Knappheit ist hier
ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass Agrarflächen zweckentfremdet werden, weil die
industrielle Nutzung mehr Profit verspricht. Agrosprit ist dabei nur eine Form der industriellen Nutzung,
eine andere, nicht weniger zerstörerische, ist der Bergbau.
 Die Erde hält einen weiteren
Bevölkerungsanstieg ohne weiteres aus. Sie erträgt auch Dürren und Überschwemmungen,
solange sie sich im bisherigen ökologischen Gleichgewicht bewegt. Was sie nicht aushält, ist die
Konzentration von bebaubarem Land in den Händen von Großkonzernen und dessen Ausbeutung nach den
Regeln des schnellen Profits. Das macht die Erde unfruchtbar und treibt die Menschen in Hungersnöte.
Die Erde hält einen weiteren
Bevölkerungsanstieg ohne weiteres aus. Sie erträgt auch Dürren und Überschwemmungen,
solange sie sich im bisherigen ökologischen Gleichgewicht bewegt. Was sie nicht aushält, ist die
Konzentration von bebaubarem Land in den Händen von Großkonzernen und dessen Ausbeutung nach den
Regeln des schnellen Profits. Das macht die Erde unfruchtbar und treibt die Menschen in Hungersnöte.
 Im Konkreten haben die Preise auf dem
Weltmarkt mit den lokalen Anbaubedingungen deshalb herzlich wenig zu tun. „Das Problem in dieser Krise
ist, dass die Weltbank die Subsistenzlandwirtschaft vernachlässigt hat”, erklärt Jean
Ziegler gegenüber der österreichischen Tageszeitung Der Standard (10.5.08).
Im Konkreten haben die Preise auf dem
Weltmarkt mit den lokalen Anbaubedingungen deshalb herzlich wenig zu tun. „Das Problem in dieser Krise
ist, dass die Weltbank die Subsistenzlandwirtschaft vernachlässigt hat”, erklärt Jean
Ziegler gegenüber der österreichischen Tageszeitung Der Standard (10.5.08).
 "Beispiel Mali: Das Land deckt seinen
Reisverbrauch über den Weltmarkt, der Reispreis ist in den vergangenen Monaten um 53% gestiegen, die
Tonne kostet 1000 Dollar. Den Entwicklungsländern wurde die Exportlandwirtschaft aufgezwungen.”
Ziegler weist auch daraufhin, dass die Menschen hungern, weil sie nicht genug Geld haben, Lebensmittel zu
kaufen, und nicht weil es nicht genug davon gäbe.
"Beispiel Mali: Das Land deckt seinen
Reisverbrauch über den Weltmarkt, der Reispreis ist in den vergangenen Monaten um 53% gestiegen, die
Tonne kostet 1000 Dollar. Den Entwicklungsländern wurde die Exportlandwirtschaft aufgezwungen.”
Ziegler weist auch daraufhin, dass die Menschen hungern, weil sie nicht genug Geld haben, Lebensmittel zu
kaufen, und nicht weil es nicht genug davon gäbe.
 Dieser Nahrungsmittelkrise kommt man nur mit
einer Agrarreform bei, die das bebaubare Land wieder in Bauernhand gibt. Dabei kann erstmals erstmals eine
direkte Interessenverbindung zwischen den Armen in den Metropolen und den Armen in den Ländern des
Südens hergestellt werden. Denn dort wie im Norden gibt es jetzt Gegner, die dieselben Namen tragen:
Monsanto, Unilever, Nestlé, Danone, Kraft, aber auch Rio Tinto Zinc u.a. Dort, wo es Industrie gibt,
stehen Arbeiter an der Spitze der Hungerrevolten. Die Forderung nach Mindestlöhnen ist mittlerweile
weltweit zu hören.
Dieser Nahrungsmittelkrise kommt man nur mit
einer Agrarreform bei, die das bebaubare Land wieder in Bauernhand gibt. Dabei kann erstmals erstmals eine
direkte Interessenverbindung zwischen den Armen in den Metropolen und den Armen in den Ländern des
Südens hergestellt werden. Denn dort wie im Norden gibt es jetzt Gegner, die dieselben Namen tragen:
Monsanto, Unilever, Nestlé, Danone, Kraft, aber auch Rio Tinto Zinc u.a. Dort, wo es Industrie gibt,
stehen Arbeiter an der Spitze der Hungerrevolten. Die Forderung nach Mindestlöhnen ist mittlerweile
weltweit zu hören.
 Globale soziale Rechte — das Recht des
Bauern, die örtliche Bevölkerung zu ernähren; das Recht des Arbeiters und Angestellten,
für die Arbeit mindestens einen Lohn zu erhalten, der mit Abstand über der Armutsgrenze liegt; und
das Recht eines jeden Menschen, auch ohne Erwerbsarbeit soviel zum Leben zu haben, dass er nicht unter die
Armutsgrenze fällt — das sind Forderungen, die eine weltweite solidarische Gegenbewegung anfeuern
können.
Globale soziale Rechte — das Recht des
Bauern, die örtliche Bevölkerung zu ernähren; das Recht des Arbeiters und Angestellten,
für die Arbeit mindestens einen Lohn zu erhalten, der mit Abstand über der Armutsgrenze liegt; und
das Recht eines jeden Menschen, auch ohne Erwerbsarbeit soviel zum Leben zu haben, dass er nicht unter die
Armutsgrenze fällt — das sind Forderungen, die eine weltweite solidarische Gegenbewegung anfeuern
können.
