| SoZ -
Sozialistische Zeitung |
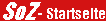 SoZ - Sozialistische Zeitung, Juni 2008, Seite 17
SoZ - Sozialistische Zeitung, Juni 2008, Seite 17
Börsenspekulation
treibt die Preise für Lebensmittel und Energie
von INGO SCHMIDT
Die Preise unserer Lebensmittel steigen, weil Chinesen und Inder mehr essen?
Das Märchen wird uns aufgetischt, seit die Milchpreise im vergangenen Jahr explodiert sind. Die wahren
Ursachen sind woanders zu suchen.
 Seit Monaten verfolgen Europäische
Zentral- und Deutsche Bundesbanker die Preisentwicklung mit Argusaugen. Auf Jahresbasis sind die
Verbraucherpreise im März dieses Jahres um 3,1% gestiegen. Das Ziel der EZB, die Inflation unter 2% zu
halten, wird schon seit März 2007 Monat für Monat verfehlt. Verantwortlich hierfür sind die
Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie. Erstere verteuerten sich im März 2008 um 8,6%,
letztere um 9,8%.
Seit Monaten verfolgen Europäische
Zentral- und Deutsche Bundesbanker die Preisentwicklung mit Argusaugen. Auf Jahresbasis sind die
Verbraucherpreise im März dieses Jahres um 3,1% gestiegen. Das Ziel der EZB, die Inflation unter 2% zu
halten, wird schon seit März 2007 Monat für Monat verfehlt. Verantwortlich hierfür sind die
Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie. Erstere verteuerten sich im März 2008 um 8,6%,
letztere um 9,8%.
 Dabei gilt noch immer, was der
preußische Statistiker Ernst Engel Mitte des 19.Jahrhunderts feststellte und was in Lehrbüchern
der Volkswirtschaftslehre seither als Engel‘sches Gesetz bezeichnet wird: Je höher das Einkommen,
desto geringer ist der Anteil, der für Lebensmittel ausgegeben wird.
Dabei gilt noch immer, was der
preußische Statistiker Ernst Engel Mitte des 19.Jahrhunderts feststellte und was in Lehrbüchern
der Volkswirtschaftslehre seither als Engel‘sches Gesetz bezeichnet wird: Je höher das Einkommen,
desto geringer ist der Anteil, der für Lebensmittel ausgegeben wird.
 Für Energie gilt das Engel‘sche
Gesetz nur in abgeschwächter Form, weil sich die Bezieher hoher Einkommen gern den Luxus dicker und
benzinfressender Autos, häufiger Flugreisen und großer Häuser mit entsprechendem Aufwand an
Heizkosten leisten. Höhere Lebensmittel- und Energiepreise sind für sie kein großes Problem.
Schlimmstenfalls stecken sie einen etwas geringeren Anteil ihres Gesamteinkommens in
Spekulationsgeschäfte als in der Vergangenheit.
Für Energie gilt das Engel‘sche
Gesetz nur in abgeschwächter Form, weil sich die Bezieher hoher Einkommen gern den Luxus dicker und
benzinfressender Autos, häufiger Flugreisen und großer Häuser mit entsprechendem Aufwand an
Heizkosten leisten. Höhere Lebensmittel- und Energiepreise sind für sie kein großes Problem.
Schlimmstenfalls stecken sie einen etwas geringeren Anteil ihres Gesamteinkommens in
Spekulationsgeschäfte als in der Vergangenheit.
 Angesichts dessen, dass Spekulation die
Preise treibt, können auch schon mit geringen Einsätzen in der Rohstoff- und
Lebensmittelspekulation enorme Gewinne gemacht werden. Für die Kaufkraft und den Lebensstandard
privater Haushalte bedeuten steigende Preise für Energie und Lebensmittel jedoch, dass arme Haushalte
stärker von der Inflation betroffen sind als reiche Haushalte.
Angesichts dessen, dass Spekulation die
Preise treibt, können auch schon mit geringen Einsätzen in der Rohstoff- und
Lebensmittelspekulation enorme Gewinne gemacht werden. Für die Kaufkraft und den Lebensstandard
privater Haushalte bedeuten steigende Preise für Energie und Lebensmittel jedoch, dass arme Haushalte
stärker von der Inflation betroffen sind als reiche Haushalte.
 Allerdings stehen nicht die Nöte der
kleinen Leute hinter den Inflationssorgen der Geldpolitiker in Frankfurt. Letztere streben nach höheren
Werten: dem Erhalt des Geldwerts sowie der Investitionsneigung von Unternehmen und reichen Haushalten. Um
dies zu erreichen, ziehen sie Zinssteigerungen in Betracht, die kurzfristig zu Nachfrageausfällen,
sinkenden Inflationsraten und steigender Arbeitslosigkeit führen.
Allerdings stehen nicht die Nöte der
kleinen Leute hinter den Inflationssorgen der Geldpolitiker in Frankfurt. Letztere streben nach höheren
Werten: dem Erhalt des Geldwerts sowie der Investitionsneigung von Unternehmen und reichen Haushalten. Um
dies zu erreichen, ziehen sie Zinssteigerungen in Betracht, die kurzfristig zu Nachfrageausfällen,
sinkenden Inflationsraten und steigender Arbeitslosigkeit führen.
 Auf diese Weise werden ärmere Haushalte
zwar ihre Inflationsprobleme los, verlieren aber auch Einkommen und Arbeitsplätze. Dass Geldpolitiker
im Namen der Geldwertstabilität bereit sind, eine kränkelnde Wirtschaft in die Rezession zu
stürzen, hat die US-Zentralbank unter ihrem damaligen Präsidenten Paul Volcker 1979 bewiesen.
Auf diese Weise werden ärmere Haushalte
zwar ihre Inflationsprobleme los, verlieren aber auch Einkommen und Arbeitsplätze. Dass Geldpolitiker
im Namen der Geldwertstabilität bereit sind, eine kränkelnde Wirtschaft in die Rezession zu
stürzen, hat die US-Zentralbank unter ihrem damaligen Präsidenten Paul Volcker 1979 bewiesen.
 Ob das EZB-Direktorium, das von der
Deutschen Bundesbank einen gemäßigten, dafür aber stetig verfolgten Monetarismus
übernommen hat, solch drastische Maßnahmen ergreifen würde, sei dahingestellt. Vorläufig
verbirgt man in Frankfurt die eigene Unsicherheit über die Tiefe der Finanzkrise und die künftig
zu verfolgende geldpolitische Strategie hinter der von Ex-Kanzler Schröder geprägten Losung einer
„Wirtschaftspolitik der ruhigen Hand”
Ob das EZB-Direktorium, das von der
Deutschen Bundesbank einen gemäßigten, dafür aber stetig verfolgten Monetarismus
übernommen hat, solch drastische Maßnahmen ergreifen würde, sei dahingestellt. Vorläufig
verbirgt man in Frankfurt die eigene Unsicherheit über die Tiefe der Finanzkrise und die künftig
zu verfolgende geldpolitische Strategie hinter der von Ex-Kanzler Schröder geprägten Losung einer
„Wirtschaftspolitik der ruhigen Hand”
 Seit Juni 2007, die Finanzkrise steckte zu
der Zeit noch in den Kinderschuhen, müssen Banken einen Zinssatz von 3% zahlen, wenn sie sich bei der
Zentralbank mit Geld eindecken. Da die US-Zentralbank, die dem Monetarismus schon lange den Rücken
gekehrt hat, seit Ausbruch der Finanzkrise die Zinsen schrittweise auf derzeit 2% gesenkt hat, was
angesichts einer Inflationsrate von 4% in den USA einem negativen Realzins entspricht, besteht eine
Zinsdifferenz, die zu einer Umschichtung von Dollar- in Euroanlagen führt.
Seit Juni 2007, die Finanzkrise steckte zu
der Zeit noch in den Kinderschuhen, müssen Banken einen Zinssatz von 3% zahlen, wenn sie sich bei der
Zentralbank mit Geld eindecken. Da die US-Zentralbank, die dem Monetarismus schon lange den Rücken
gekehrt hat, seit Ausbruch der Finanzkrise die Zinsen schrittweise auf derzeit 2% gesenkt hat, was
angesichts einer Inflationsrate von 4% in den USA einem negativen Realzins entspricht, besteht eine
Zinsdifferenz, die zu einer Umschichtung von Dollar- in Euroanlagen führt.
 Während die gegenwärtige Rohstoff-
und Lebensmittelinflation in den kapitalistischen Zentren kleinen Leuten das Leben schwer macht und
Zentralbanker in Frankfurt und Washington zu sehr unterschiedlichen geldpolitischen Reaktionen geführt
hat, haben die Armen dieser Welt mit sehr viel grundlegenderen Problemen zu kämpfen. Von März 2007
bis März 2008 sind die Weltmarktpreise für Getreide um 88% gestiegen, Speiseöle und Fette
verteuerten sich um 106%, Molkereiprodukte um 49%.
Während die gegenwärtige Rohstoff-
und Lebensmittelinflation in den kapitalistischen Zentren kleinen Leuten das Leben schwer macht und
Zentralbanker in Frankfurt und Washington zu sehr unterschiedlichen geldpolitischen Reaktionen geführt
hat, haben die Armen dieser Welt mit sehr viel grundlegenderen Problemen zu kämpfen. Von März 2007
bis März 2008 sind die Weltmarktpreise für Getreide um 88% gestiegen, Speiseöle und Fette
verteuerten sich um 106%, Molkereiprodukte um 49%.
 Zentralbanker, die dank ihrer hohen
Einkommen und dem Engel‘schen Gesetz nur einen geringen Teil ihrer Gesamtausgaben für derartig
banale Dinge ausgeben, sehen in diesen Zahlen erst dann ein Problem, wenn sie gesamtwirtschaftliche
Inflationsprozesse und damit eine reale Entwertung von Geldvermögen auslösen. Für die Armen
dieser Welt bedeuten diese Zahlen Hunger, weil die täglich notwendigen Kalorien unbezahlbar werden.
Zentralbanker, die dank ihrer hohen
Einkommen und dem Engel‘schen Gesetz nur einen geringen Teil ihrer Gesamtausgaben für derartig
banale Dinge ausgeben, sehen in diesen Zahlen erst dann ein Problem, wenn sie gesamtwirtschaftliche
Inflationsprozesse und damit eine reale Entwertung von Geldvermögen auslösen. Für die Armen
dieser Welt bedeuten diese Zahlen Hunger, weil die täglich notwendigen Kalorien unbezahlbar werden.
 Dieser Hunger ist aufs engste mit dem
bereits erwähnten Volcker-Schock verbunden. Der von Volcker erstmals praktisch angewandte Monetarismus
war ja nur ein Teil des neoliberalen Projekts, das seit den späten 70er Jahren von den herrschenden
Klassen der Zentren und einigen ihnen verbündeten Kompradorenbourgeoisien verfolgt wurde.
Dieser Hunger ist aufs engste mit dem
bereits erwähnten Volcker-Schock verbunden. Der von Volcker erstmals praktisch angewandte Monetarismus
war ja nur ein Teil des neoliberalen Projekts, das seit den späten 70er Jahren von den herrschenden
Klassen der Zentren und einigen ihnen verbündeten Kompradorenbourgeoisien verfolgt wurde.
 Ein anderer Bestandteil dieses Projekts war
eine gigantische Welle ursprünglicher Akkumulation. In deren Verlauf wurde eine kleine Zahl von Bauern,
die sich zuvor selbst versorgen und ihre Überschüsse auf nationalen Märkten verkaufen
konnten, zu bezahlten Landarbeitern auf ihrem ehemaligen Boden. Die große Mehrheit zog in die
Städte, wo wiederum ein kleiner Teil Beschäftigung in den entstehenden Weltmarktfabriken fand, die
Mehrheit aber sich im schnell wachsenden informellen Sektor durchschlug.
Ein anderer Bestandteil dieses Projekts war
eine gigantische Welle ursprünglicher Akkumulation. In deren Verlauf wurde eine kleine Zahl von Bauern,
die sich zuvor selbst versorgen und ihre Überschüsse auf nationalen Märkten verkaufen
konnten, zu bezahlten Landarbeitern auf ihrem ehemaligen Boden. Die große Mehrheit zog in die
Städte, wo wiederum ein kleiner Teil Beschäftigung in den entstehenden Weltmarktfabriken fand, die
Mehrheit aber sich im schnell wachsenden informellen Sektor durchschlug.
 Landlose Bauern und Angehörige des
informellen Sektors stellen die große Masse der Armen, deren Lebensmittelversorgung sich in Folge der
gegenwärtigen Preiserhöhungen weiter verschlechtert.
Landlose Bauern und Angehörige des
informellen Sektors stellen die große Masse der Armen, deren Lebensmittelversorgung sich in Folge der
gegenwärtigen Preiserhöhungen weiter verschlechtert.
 Wegen dem ihnen aufgezwungenen
exportorientierten Agrarkapitalismus müssen viele Länder, die bis in die 70er Jahre
Selbstversorger mit Lebensmitteln waren, einen steigenden Anteil ihres Lebensmittelbedarfs durch Importe
decken. Auf diese Weise werden sie einen guten Teil der Devisen, die sie durch den Anbau und Export von Cash
Crops sauer verdient haben, gleich wieder los.
Wegen dem ihnen aufgezwungenen
exportorientierten Agrarkapitalismus müssen viele Länder, die bis in die 70er Jahre
Selbstversorger mit Lebensmitteln waren, einen steigenden Anteil ihres Lebensmittelbedarfs durch Importe
decken. Auf diese Weise werden sie einen guten Teil der Devisen, die sie durch den Anbau und Export von Cash
Crops sauer verdient haben, gleich wieder los.
 Die Ausweitung und Vertiefung des Weltmarkts
für Agrarprodukte erlaubt die gemeinschaftliche Bereicherung von Agrarkapitalisten in den Zentren und
Peripherien und erhöht die Devisenabhängigkeit der Arbeiter — zu denen auch die im
informellen Sektor Tätigen zu zählen sind — und Bauern in den Peripherien.
Die Ausweitung und Vertiefung des Weltmarkts
für Agrarprodukte erlaubt die gemeinschaftliche Bereicherung von Agrarkapitalisten in den Zentren und
Peripherien und erhöht die Devisenabhängigkeit der Arbeiter — zu denen auch die im
informellen Sektor Tätigen zu zählen sind — und Bauern in den Peripherien.
 Darüber hinaus bietet der Agrarsektor
seit dem Ende des Immobilenbooms in den USA ein willkommenes Auffangbecken für Spekulationskapital
— gleiches gilt für Energie und andere Rohstoffe.
Darüber hinaus bietet der Agrarsektor
seit dem Ende des Immobilenbooms in den USA ein willkommenes Auffangbecken für Spekulationskapital
— gleiches gilt für Energie und andere Rohstoffe.
 Das neoliberale Herrschaftsprojekt hat zwar
die Einkommens- und Machtansprüche der subalternen Klassen auf der ganzen Welt erfolgreich
zurückdrängen können und ungeahnte Profitmassen in die Taschen der Bourgeoisien gespült,
konnte aber zu keiner Zeit ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten im produktiven Kapitalkreislauf
schaffen. Diese „Überschussprofite” sind in den 90er Jahren in den IT-Sektor, und in den
vergangenen Jahren in den Immobiliensektor der USA und einiger anderer Länder geflossen. Beide Male kam
es zu einer Spekulationsblase mit anschließender Finanzkrise.
Das neoliberale Herrschaftsprojekt hat zwar
die Einkommens- und Machtansprüche der subalternen Klassen auf der ganzen Welt erfolgreich
zurückdrängen können und ungeahnte Profitmassen in die Taschen der Bourgeoisien gespült,
konnte aber zu keiner Zeit ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten im produktiven Kapitalkreislauf
schaffen. Diese „Überschussprofite” sind in den 90er Jahren in den IT-Sektor, und in den
vergangenen Jahren in den Immobiliensektor der USA und einiger anderer Länder geflossen. Beide Male kam
es zu einer Spekulationsblase mit anschließender Finanzkrise.
 Obwohl die Finanzkrisen zur Vernichtung
erheblicher Mengen fiktiven Kapitals geführt haben, spülen die Fortsetzung der ursprünglichen
Akkumulation und die Umverteilung des Reichtums von den Lohnarbeitern zu den Kapitalisten weiterhin Profite
auf die internationalen Kapitalmärkte, für die es keine profitablen Anlagemöglichkeiten gibt.
Von dort fließen sie nun in die Lebensmittel-, Energie- und sonstige Rohstoffspekulationen.
Obwohl die Finanzkrisen zur Vernichtung
erheblicher Mengen fiktiven Kapitals geführt haben, spülen die Fortsetzung der ursprünglichen
Akkumulation und die Umverteilung des Reichtums von den Lohnarbeitern zu den Kapitalisten weiterhin Profite
auf die internationalen Kapitalmärkte, für die es keine profitablen Anlagemöglichkeiten gibt.
Von dort fließen sie nun in die Lebensmittel-, Energie- und sonstige Rohstoffspekulationen.
 Der ökologische Raubbau, den die
kapitalistisch entwickelten Produktivkräfte betreiben, kann langfristig zu Versorgungsengpässen
und zur völligen Erschöpfung bestimmter Rohstoffe führen. Die damit eintretende Verknappung
des Angebots dieser Güter wird auch zu steigenden Preisen führen. Die gegenwärtigen
Preissteigerungen sind allerdings nicht durch ein unzureichendes Angebot, sondern durch die Spekulation auf
Preiserhöhungen begründet.
Der ökologische Raubbau, den die
kapitalistisch entwickelten Produktivkräfte betreiben, kann langfristig zu Versorgungsengpässen
und zur völligen Erschöpfung bestimmter Rohstoffe führen. Die damit eintretende Verknappung
des Angebots dieser Güter wird auch zu steigenden Preisen führen. Die gegenwärtigen
Preissteigerungen sind allerdings nicht durch ein unzureichendes Angebot, sondern durch die Spekulation auf
Preiserhöhungen begründet.
Ich möchte die SoZ mal in der Hand halten
und bestelle eine kostenlose Probeausgabe oder ein Probeabo
|
|

|
|
Sozialistische Hefte
für Theorie und Praxis
Sonderausgabe der SoZ
42 Seiten, 5 Euro,
|
|
|
Der Stand der Dinge
Perry Anderson überblickt den westpolitischen Stand der Dinge
Gregory Albo untersucht den anhaltenden politischen Erfolg des Neoliberalismus und die Schwäche der Linken
Alfredo Saa-Fidho verdeutlicht die Unterschiede der keynsianischen und der marxistischen Kritik des Neoliberalismus
Ulrich Duchrow fragt nach den psychischen Mechanismen und Kosten des Neoliberlismus
Walter Benn Michaelis sieht in Barack Obama das neue Pin-Up des Neoliberalismus und zeigt, dass es nicht reicht, nur von Vielfalt zu reden
Christoph Jünke über Karl Liebknechts Aktualität
|
|

 Seit Monaten verfolgen Europäische
Zentral- und Deutsche Bundesbanker die Preisentwicklung mit Argusaugen. Auf Jahresbasis sind die
Verbraucherpreise im März dieses Jahres um 3,1% gestiegen. Das Ziel der EZB, die Inflation unter 2% zu
halten, wird schon seit März 2007 Monat für Monat verfehlt. Verantwortlich hierfür sind die
Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie. Erstere verteuerten sich im März 2008 um 8,6%,
letztere um 9,8%.
Seit Monaten verfolgen Europäische
Zentral- und Deutsche Bundesbanker die Preisentwicklung mit Argusaugen. Auf Jahresbasis sind die
Verbraucherpreise im März dieses Jahres um 3,1% gestiegen. Das Ziel der EZB, die Inflation unter 2% zu
halten, wird schon seit März 2007 Monat für Monat verfehlt. Verantwortlich hierfür sind die
Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie. Erstere verteuerten sich im März 2008 um 8,6%,
letztere um 9,8%.
 Dabei gilt noch immer, was der
preußische Statistiker Ernst Engel Mitte des 19.Jahrhunderts feststellte und was in Lehrbüchern
der Volkswirtschaftslehre seither als Engel‘sches Gesetz bezeichnet wird: Je höher das Einkommen,
desto geringer ist der Anteil, der für Lebensmittel ausgegeben wird.
Dabei gilt noch immer, was der
preußische Statistiker Ernst Engel Mitte des 19.Jahrhunderts feststellte und was in Lehrbüchern
der Volkswirtschaftslehre seither als Engel‘sches Gesetz bezeichnet wird: Je höher das Einkommen,
desto geringer ist der Anteil, der für Lebensmittel ausgegeben wird.
 Für Energie gilt das Engel‘sche
Gesetz nur in abgeschwächter Form, weil sich die Bezieher hoher Einkommen gern den Luxus dicker und
benzinfressender Autos, häufiger Flugreisen und großer Häuser mit entsprechendem Aufwand an
Heizkosten leisten. Höhere Lebensmittel- und Energiepreise sind für sie kein großes Problem.
Schlimmstenfalls stecken sie einen etwas geringeren Anteil ihres Gesamteinkommens in
Spekulationsgeschäfte als in der Vergangenheit.
Für Energie gilt das Engel‘sche
Gesetz nur in abgeschwächter Form, weil sich die Bezieher hoher Einkommen gern den Luxus dicker und
benzinfressender Autos, häufiger Flugreisen und großer Häuser mit entsprechendem Aufwand an
Heizkosten leisten. Höhere Lebensmittel- und Energiepreise sind für sie kein großes Problem.
Schlimmstenfalls stecken sie einen etwas geringeren Anteil ihres Gesamteinkommens in
Spekulationsgeschäfte als in der Vergangenheit.
 Angesichts dessen, dass Spekulation die
Preise treibt, können auch schon mit geringen Einsätzen in der Rohstoff- und
Lebensmittelspekulation enorme Gewinne gemacht werden. Für die Kaufkraft und den Lebensstandard
privater Haushalte bedeuten steigende Preise für Energie und Lebensmittel jedoch, dass arme Haushalte
stärker von der Inflation betroffen sind als reiche Haushalte.
Angesichts dessen, dass Spekulation die
Preise treibt, können auch schon mit geringen Einsätzen in der Rohstoff- und
Lebensmittelspekulation enorme Gewinne gemacht werden. Für die Kaufkraft und den Lebensstandard
privater Haushalte bedeuten steigende Preise für Energie und Lebensmittel jedoch, dass arme Haushalte
stärker von der Inflation betroffen sind als reiche Haushalte.
 Allerdings stehen nicht die Nöte der
kleinen Leute hinter den Inflationssorgen der Geldpolitiker in Frankfurt. Letztere streben nach höheren
Werten: dem Erhalt des Geldwerts sowie der Investitionsneigung von Unternehmen und reichen Haushalten. Um
dies zu erreichen, ziehen sie Zinssteigerungen in Betracht, die kurzfristig zu Nachfrageausfällen,
sinkenden Inflationsraten und steigender Arbeitslosigkeit führen.
Allerdings stehen nicht die Nöte der
kleinen Leute hinter den Inflationssorgen der Geldpolitiker in Frankfurt. Letztere streben nach höheren
Werten: dem Erhalt des Geldwerts sowie der Investitionsneigung von Unternehmen und reichen Haushalten. Um
dies zu erreichen, ziehen sie Zinssteigerungen in Betracht, die kurzfristig zu Nachfrageausfällen,
sinkenden Inflationsraten und steigender Arbeitslosigkeit führen.
 Auf diese Weise werden ärmere Haushalte
zwar ihre Inflationsprobleme los, verlieren aber auch Einkommen und Arbeitsplätze. Dass Geldpolitiker
im Namen der Geldwertstabilität bereit sind, eine kränkelnde Wirtschaft in die Rezession zu
stürzen, hat die US-Zentralbank unter ihrem damaligen Präsidenten Paul Volcker 1979 bewiesen.
Auf diese Weise werden ärmere Haushalte
zwar ihre Inflationsprobleme los, verlieren aber auch Einkommen und Arbeitsplätze. Dass Geldpolitiker
im Namen der Geldwertstabilität bereit sind, eine kränkelnde Wirtschaft in die Rezession zu
stürzen, hat die US-Zentralbank unter ihrem damaligen Präsidenten Paul Volcker 1979 bewiesen.
 Ob das EZB-Direktorium, das von der
Deutschen Bundesbank einen gemäßigten, dafür aber stetig verfolgten Monetarismus
übernommen hat, solch drastische Maßnahmen ergreifen würde, sei dahingestellt. Vorläufig
verbirgt man in Frankfurt die eigene Unsicherheit über die Tiefe der Finanzkrise und die künftig
zu verfolgende geldpolitische Strategie hinter der von Ex-Kanzler Schröder geprägten Losung einer
„Wirtschaftspolitik der ruhigen Hand”
Ob das EZB-Direktorium, das von der
Deutschen Bundesbank einen gemäßigten, dafür aber stetig verfolgten Monetarismus
übernommen hat, solch drastische Maßnahmen ergreifen würde, sei dahingestellt. Vorläufig
verbirgt man in Frankfurt die eigene Unsicherheit über die Tiefe der Finanzkrise und die künftig
zu verfolgende geldpolitische Strategie hinter der von Ex-Kanzler Schröder geprägten Losung einer
„Wirtschaftspolitik der ruhigen Hand”
 Seit Juni 2007, die Finanzkrise steckte zu
der Zeit noch in den Kinderschuhen, müssen Banken einen Zinssatz von 3% zahlen, wenn sie sich bei der
Zentralbank mit Geld eindecken. Da die US-Zentralbank, die dem Monetarismus schon lange den Rücken
gekehrt hat, seit Ausbruch der Finanzkrise die Zinsen schrittweise auf derzeit 2% gesenkt hat, was
angesichts einer Inflationsrate von 4% in den USA einem negativen Realzins entspricht, besteht eine
Zinsdifferenz, die zu einer Umschichtung von Dollar- in Euroanlagen führt.
Seit Juni 2007, die Finanzkrise steckte zu
der Zeit noch in den Kinderschuhen, müssen Banken einen Zinssatz von 3% zahlen, wenn sie sich bei der
Zentralbank mit Geld eindecken. Da die US-Zentralbank, die dem Monetarismus schon lange den Rücken
gekehrt hat, seit Ausbruch der Finanzkrise die Zinsen schrittweise auf derzeit 2% gesenkt hat, was
angesichts einer Inflationsrate von 4% in den USA einem negativen Realzins entspricht, besteht eine
Zinsdifferenz, die zu einer Umschichtung von Dollar- in Euroanlagen führt.
 Während die gegenwärtige Rohstoff-
und Lebensmittelinflation in den kapitalistischen Zentren kleinen Leuten das Leben schwer macht und
Zentralbanker in Frankfurt und Washington zu sehr unterschiedlichen geldpolitischen Reaktionen geführt
hat, haben die Armen dieser Welt mit sehr viel grundlegenderen Problemen zu kämpfen. Von März 2007
bis März 2008 sind die Weltmarktpreise für Getreide um 88% gestiegen, Speiseöle und Fette
verteuerten sich um 106%, Molkereiprodukte um 49%.
Während die gegenwärtige Rohstoff-
und Lebensmittelinflation in den kapitalistischen Zentren kleinen Leuten das Leben schwer macht und
Zentralbanker in Frankfurt und Washington zu sehr unterschiedlichen geldpolitischen Reaktionen geführt
hat, haben die Armen dieser Welt mit sehr viel grundlegenderen Problemen zu kämpfen. Von März 2007
bis März 2008 sind die Weltmarktpreise für Getreide um 88% gestiegen, Speiseöle und Fette
verteuerten sich um 106%, Molkereiprodukte um 49%.
 Zentralbanker, die dank ihrer hohen
Einkommen und dem Engel‘schen Gesetz nur einen geringen Teil ihrer Gesamtausgaben für derartig
banale Dinge ausgeben, sehen in diesen Zahlen erst dann ein Problem, wenn sie gesamtwirtschaftliche
Inflationsprozesse und damit eine reale Entwertung von Geldvermögen auslösen. Für die Armen
dieser Welt bedeuten diese Zahlen Hunger, weil die täglich notwendigen Kalorien unbezahlbar werden.
Zentralbanker, die dank ihrer hohen
Einkommen und dem Engel‘schen Gesetz nur einen geringen Teil ihrer Gesamtausgaben für derartig
banale Dinge ausgeben, sehen in diesen Zahlen erst dann ein Problem, wenn sie gesamtwirtschaftliche
Inflationsprozesse und damit eine reale Entwertung von Geldvermögen auslösen. Für die Armen
dieser Welt bedeuten diese Zahlen Hunger, weil die täglich notwendigen Kalorien unbezahlbar werden.
 Dieser Hunger ist aufs engste mit dem
bereits erwähnten Volcker-Schock verbunden. Der von Volcker erstmals praktisch angewandte Monetarismus
war ja nur ein Teil des neoliberalen Projekts, das seit den späten 70er Jahren von den herrschenden
Klassen der Zentren und einigen ihnen verbündeten Kompradorenbourgeoisien verfolgt wurde.
Dieser Hunger ist aufs engste mit dem
bereits erwähnten Volcker-Schock verbunden. Der von Volcker erstmals praktisch angewandte Monetarismus
war ja nur ein Teil des neoliberalen Projekts, das seit den späten 70er Jahren von den herrschenden
Klassen der Zentren und einigen ihnen verbündeten Kompradorenbourgeoisien verfolgt wurde.
 Ein anderer Bestandteil dieses Projekts war
eine gigantische Welle ursprünglicher Akkumulation. In deren Verlauf wurde eine kleine Zahl von Bauern,
die sich zuvor selbst versorgen und ihre Überschüsse auf nationalen Märkten verkaufen
konnten, zu bezahlten Landarbeitern auf ihrem ehemaligen Boden. Die große Mehrheit zog in die
Städte, wo wiederum ein kleiner Teil Beschäftigung in den entstehenden Weltmarktfabriken fand, die
Mehrheit aber sich im schnell wachsenden informellen Sektor durchschlug.
Ein anderer Bestandteil dieses Projekts war
eine gigantische Welle ursprünglicher Akkumulation. In deren Verlauf wurde eine kleine Zahl von Bauern,
die sich zuvor selbst versorgen und ihre Überschüsse auf nationalen Märkten verkaufen
konnten, zu bezahlten Landarbeitern auf ihrem ehemaligen Boden. Die große Mehrheit zog in die
Städte, wo wiederum ein kleiner Teil Beschäftigung in den entstehenden Weltmarktfabriken fand, die
Mehrheit aber sich im schnell wachsenden informellen Sektor durchschlug.
 Landlose Bauern und Angehörige des
informellen Sektors stellen die große Masse der Armen, deren Lebensmittelversorgung sich in Folge der
gegenwärtigen Preiserhöhungen weiter verschlechtert.
Landlose Bauern und Angehörige des
informellen Sektors stellen die große Masse der Armen, deren Lebensmittelversorgung sich in Folge der
gegenwärtigen Preiserhöhungen weiter verschlechtert.
 Wegen dem ihnen aufgezwungenen
exportorientierten Agrarkapitalismus müssen viele Länder, die bis in die 70er Jahre
Selbstversorger mit Lebensmitteln waren, einen steigenden Anteil ihres Lebensmittelbedarfs durch Importe
decken. Auf diese Weise werden sie einen guten Teil der Devisen, die sie durch den Anbau und Export von Cash
Crops sauer verdient haben, gleich wieder los.
Wegen dem ihnen aufgezwungenen
exportorientierten Agrarkapitalismus müssen viele Länder, die bis in die 70er Jahre
Selbstversorger mit Lebensmitteln waren, einen steigenden Anteil ihres Lebensmittelbedarfs durch Importe
decken. Auf diese Weise werden sie einen guten Teil der Devisen, die sie durch den Anbau und Export von Cash
Crops sauer verdient haben, gleich wieder los.
 Die Ausweitung und Vertiefung des Weltmarkts
für Agrarprodukte erlaubt die gemeinschaftliche Bereicherung von Agrarkapitalisten in den Zentren und
Peripherien und erhöht die Devisenabhängigkeit der Arbeiter — zu denen auch die im
informellen Sektor Tätigen zu zählen sind — und Bauern in den Peripherien.
Die Ausweitung und Vertiefung des Weltmarkts
für Agrarprodukte erlaubt die gemeinschaftliche Bereicherung von Agrarkapitalisten in den Zentren und
Peripherien und erhöht die Devisenabhängigkeit der Arbeiter — zu denen auch die im
informellen Sektor Tätigen zu zählen sind — und Bauern in den Peripherien.
 Darüber hinaus bietet der Agrarsektor
seit dem Ende des Immobilenbooms in den USA ein willkommenes Auffangbecken für Spekulationskapital
— gleiches gilt für Energie und andere Rohstoffe.
Darüber hinaus bietet der Agrarsektor
seit dem Ende des Immobilenbooms in den USA ein willkommenes Auffangbecken für Spekulationskapital
— gleiches gilt für Energie und andere Rohstoffe.
 Das neoliberale Herrschaftsprojekt hat zwar
die Einkommens- und Machtansprüche der subalternen Klassen auf der ganzen Welt erfolgreich
zurückdrängen können und ungeahnte Profitmassen in die Taschen der Bourgeoisien gespült,
konnte aber zu keiner Zeit ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten im produktiven Kapitalkreislauf
schaffen. Diese „Überschussprofite” sind in den 90er Jahren in den IT-Sektor, und in den
vergangenen Jahren in den Immobiliensektor der USA und einiger anderer Länder geflossen. Beide Male kam
es zu einer Spekulationsblase mit anschließender Finanzkrise.
Das neoliberale Herrschaftsprojekt hat zwar
die Einkommens- und Machtansprüche der subalternen Klassen auf der ganzen Welt erfolgreich
zurückdrängen können und ungeahnte Profitmassen in die Taschen der Bourgeoisien gespült,
konnte aber zu keiner Zeit ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten im produktiven Kapitalkreislauf
schaffen. Diese „Überschussprofite” sind in den 90er Jahren in den IT-Sektor, und in den
vergangenen Jahren in den Immobiliensektor der USA und einiger anderer Länder geflossen. Beide Male kam
es zu einer Spekulationsblase mit anschließender Finanzkrise.
 Obwohl die Finanzkrisen zur Vernichtung
erheblicher Mengen fiktiven Kapitals geführt haben, spülen die Fortsetzung der ursprünglichen
Akkumulation und die Umverteilung des Reichtums von den Lohnarbeitern zu den Kapitalisten weiterhin Profite
auf die internationalen Kapitalmärkte, für die es keine profitablen Anlagemöglichkeiten gibt.
Von dort fließen sie nun in die Lebensmittel-, Energie- und sonstige Rohstoffspekulationen.
Obwohl die Finanzkrisen zur Vernichtung
erheblicher Mengen fiktiven Kapitals geführt haben, spülen die Fortsetzung der ursprünglichen
Akkumulation und die Umverteilung des Reichtums von den Lohnarbeitern zu den Kapitalisten weiterhin Profite
auf die internationalen Kapitalmärkte, für die es keine profitablen Anlagemöglichkeiten gibt.
Von dort fließen sie nun in die Lebensmittel-, Energie- und sonstige Rohstoffspekulationen.
 Der ökologische Raubbau, den die
kapitalistisch entwickelten Produktivkräfte betreiben, kann langfristig zu Versorgungsengpässen
und zur völligen Erschöpfung bestimmter Rohstoffe führen. Die damit eintretende Verknappung
des Angebots dieser Güter wird auch zu steigenden Preisen führen. Die gegenwärtigen
Preissteigerungen sind allerdings nicht durch ein unzureichendes Angebot, sondern durch die Spekulation auf
Preiserhöhungen begründet.
Der ökologische Raubbau, den die
kapitalistisch entwickelten Produktivkräfte betreiben, kann langfristig zu Versorgungsengpässen
und zur völligen Erschöpfung bestimmter Rohstoffe führen. Die damit eintretende Verknappung
des Angebots dieser Güter wird auch zu steigenden Preisen führen. Die gegenwärtigen
Preissteigerungen sind allerdings nicht durch ein unzureichendes Angebot, sondern durch die Spekulation auf
Preiserhöhungen begründet.
