| SoZ - Sozialistische
Zeitung |
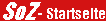 SoZ - Sozialistische Zeitung, September 2008, Seite 16
SoZ - Sozialistische Zeitung, September 2008, Seite 16
Die Globalisierungsfalle
Das CAW-Magna-Abkommen und der Kurswechel der Autogewerkschaft in Kanada
von Ingo Schmidt
Wie die CAW von einem einst kämpferischen Kurs auf protektionistische und sozialpartnerschaftliche Abwege geraten ist.
 Jahrelang bemühten sich die Canadian Auto Workers (CAW) darum, die kanadischen Betriebe von Magna
International, einem der weltgrößten Automobilzulieferer, gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifverträge auszuhandeln.
Jahrelang bemühten sich die Canadian Auto Workers (CAW) darum, die kanadischen Betriebe von Magna
International, einem der weltgrößten Automobilzulieferer, gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifverträge auszuhandeln.
 In Kanada, ebenso wie in anderen angelsächsischen Ländern, muss die Anerkennung von Gewerkschaften
und Tarifverträgen auf Betriebsebene errungen werden. Gegen eine strikt antigewerkschaftliche Unternehmensleitung konnte die CAW in diesem mühseligen
„Häuserkampf” — Magna beschäftigt in Kanada 18000 Arbeiter in 45 Niederlassungen — nur vereinzelte Erfolge erzielen. Umso
überraschter waren die CAW-Mitglieder und die kanadische Öffentlichkeit, als Magna-Chef Frank Stronach und CAW-Präsident Buzz Hargrove im Oktober 2007 einen
Vertrag vorstellten, der der Gewerkschaft erlaubt, pro Jahr fünf Magna-Betriebe zu organisieren. Nach neun Jahren wäre die CAW demnach in allen kanadischen Magna-
Werken vertreten.
In Kanada, ebenso wie in anderen angelsächsischen Ländern, muss die Anerkennung von Gewerkschaften
und Tarifverträgen auf Betriebsebene errungen werden. Gegen eine strikt antigewerkschaftliche Unternehmensleitung konnte die CAW in diesem mühseligen
„Häuserkampf” — Magna beschäftigt in Kanada 18000 Arbeiter in 45 Niederlassungen — nur vereinzelte Erfolge erzielen. Umso
überraschter waren die CAW-Mitglieder und die kanadische Öffentlichkeit, als Magna-Chef Frank Stronach und CAW-Präsident Buzz Hargrove im Oktober 2007 einen
Vertrag vorstellten, der der Gewerkschaft erlaubt, pro Jahr fünf Magna-Betriebe zu organisieren. Nach neun Jahren wäre die CAW demnach in allen kanadischen Magna-
Werken vertreten.
 Bereits einen Monat später wurde für die Beschäftigten des Magna-Werks Windsor Modules ein
Tarifvertrag abgeschlossen, der bei einer Laufzeit von drei Jahren eine sofortige Lohnerhöhung von 3 Dollar pro Stunde, prozentuale Erhöhungen in den Folgejahren sowie
Arbeitsplatzgarantien und bezahlte Fortbildungen enthält. Im Vergleich zu den Tarifabschlüssen in anderen Betrieben und Wirtschaftsbereichen kann sich dieser Abschluss sehen
lassen — umso mehr, wenn man die aktuelle Krise der kanadischen und weltweiten Automobilindustrie berücksichtigt. Es sei nur daran erinnert, dass Ende 2005 eine andere
Zulieferfirma, Delphi, Konkurs angemeldet hat, um die zu zahlenden Löhne um zwei Drittel (!) zu senken, und in der Folge massiv Stellen abgebaut hat.
Bereits einen Monat später wurde für die Beschäftigten des Magna-Werks Windsor Modules ein
Tarifvertrag abgeschlossen, der bei einer Laufzeit von drei Jahren eine sofortige Lohnerhöhung von 3 Dollar pro Stunde, prozentuale Erhöhungen in den Folgejahren sowie
Arbeitsplatzgarantien und bezahlte Fortbildungen enthält. Im Vergleich zu den Tarifabschlüssen in anderen Betrieben und Wirtschaftsbereichen kann sich dieser Abschluss sehen
lassen — umso mehr, wenn man die aktuelle Krise der kanadischen und weltweiten Automobilindustrie berücksichtigt. Es sei nur daran erinnert, dass Ende 2005 eine andere
Zulieferfirma, Delphi, Konkurs angemeldet hat, um die zu zahlenden Löhne um zwei Drittel (!) zu senken, und in der Folge massiv Stellen abgebaut hat.
 Dennoch wurde das CAW-Magna-Abkommen heftig kritisiert. Insbesondere ältere Gewerkschaftsaktive, die die
CAW seit 1985 als eine kämpferische Gewerkschaft in Abgrenzung von den sozialpartnerschaflichen United Auto Workers (UAW) aufgebaut haben, sehen in dem Abkommen mit
Magna keinen Durchbruch, sondern einen Kurswechsel der Gewerkschaftsführung in Richtung Sozialpartnerschaft und „Concession Bargaining”
Dennoch wurde das CAW-Magna-Abkommen heftig kritisiert. Insbesondere ältere Gewerkschaftsaktive, die die
CAW seit 1985 als eine kämpferische Gewerkschaft in Abgrenzung von den sozialpartnerschaflichen United Auto Workers (UAW) aufgebaut haben, sehen in dem Abkommen mit
Magna keinen Durchbruch, sondern einen Kurswechsel der Gewerkschaftsführung in Richtung Sozialpartnerschaft und „Concession Bargaining”
 Drei Punkte stießen auf besondere Ablehnung:
Drei Punkte stießen auf besondere Ablehnung:
 — Erstens erklären sich die CAW damit einverstanden, dass Magna-Beschäftigte nicht streiken
dürfen.
— Erstens erklären sich die CAW damit einverstanden, dass Magna-Beschäftigte nicht streiken
dürfen.
 — Zweitens sollen die Belegschaftsvertreter nicht von den Gewerkschaftsmitgliedern gewählt, sondern von
einem aus Unternehmens- und Gewerkschaftsvertretern zusammengesetzten Komitee ernannt werden.
— Zweitens sollen die Belegschaftsvertreter nicht von den Gewerkschaftsmitgliedern gewählt, sondern von
einem aus Unternehmens- und Gewerkschaftsvertretern zusammengesetzten Komitee ernannt werden.
 — Drittens sind Gewerkschaft und Belegschaftsvertreter den Unternehmenszielen verpflichtet; Aktivitäten,
die die Belegschaften politisieren und in Gegensatz zur Unternehmensleitung bringen können, sind untersagt.
— Drittens sind Gewerkschaft und Belegschaftsvertreter den Unternehmenszielen verpflichtet; Aktivitäten,
die die Belegschaften politisieren und in Gegensatz zur Unternehmensleitung bringen können, sind untersagt.
 Unter diesen Bedingungen, so lautet die Kritik, können die Beschäftigten bei Magna ihre Einkommens- und
Arbeitsbedingungen trotz formaler Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht verbessern. Darüber hinaus würden Unternehmen, in denen Gewerkschaftsmitglieder gegenwärtig
deutlich mehr Rechte und höhere soziale Standards haben, mit Verweis auf Magna in Zukunft deutliche Zugeständnisse bei Einkommen und Arbeitsbedingungen verlangen.
Kurz, statt eines Einbruchs in bislang gewerkschaftsfreies Terrain, wie er von Buzz Hargrove gefeiert wird, sehen Kritiker im CAW-Magna-Abkommen ein Signal, unter formaler
Anerkennung der Gewerkschaften materielle Zugeständnisse von der Mitgliedschaft zu fordern.
Unter diesen Bedingungen, so lautet die Kritik, können die Beschäftigten bei Magna ihre Einkommens- und
Arbeitsbedingungen trotz formaler Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht verbessern. Darüber hinaus würden Unternehmen, in denen Gewerkschaftsmitglieder gegenwärtig
deutlich mehr Rechte und höhere soziale Standards haben, mit Verweis auf Magna in Zukunft deutliche Zugeständnisse bei Einkommen und Arbeitsbedingungen verlangen.
Kurz, statt eines Einbruchs in bislang gewerkschaftsfreies Terrain, wie er von Buzz Hargrove gefeiert wird, sehen Kritiker im CAW-Magna-Abkommen ein Signal, unter formaler
Anerkennung der Gewerkschaften materielle Zugeständnisse von der Mitgliedschaft zu fordern.
 Dieser Kritik hält Hargrove entgegen, dass es zunächst einmal darum gegangen sei, bei Magna einen
Fuß in die Tür zu bekommen. Sobald die formale Anerkennung der Gewerkschaft erreicht sei, könnten nicht nur schrittweise bessere materielle Bedingungen durchgesetzt,
sondern schließlich auch volle gewerkschaftliche Rechte inkl. Streikrecht und Wahl von Belegschaftsvertretern durchgesetzt werden.
Dieser Kritik hält Hargrove entgegen, dass es zunächst einmal darum gegangen sei, bei Magna einen
Fuß in die Tür zu bekommen. Sobald die formale Anerkennung der Gewerkschaft erreicht sei, könnten nicht nur schrittweise bessere materielle Bedingungen durchgesetzt,
sondern schließlich auch volle gewerkschaftliche Rechte inkl. Streikrecht und Wahl von Belegschaftsvertretern durchgesetzt werden.
 In der Geschichte der Arbeiterbewegung hat es immer wieder Fälle gegeben, in denen sich bescheidene
Anfänge formeller Anerkennung als Ausgangspunkt von Gegenmacht und materiellen Zugewinnen erwiesen haben, insofern ist das Argument nicht ohne weiteres von der Hand zu
weisen. Allerdings haben sich solche Entwicklungen immer nur als Folge einer Mobilisierung der Mitgliedschaft und Koalitionen über die Gewerkschaft hinaus ergeben.
In der Geschichte der Arbeiterbewegung hat es immer wieder Fälle gegeben, in denen sich bescheidene
Anfänge formeller Anerkennung als Ausgangspunkt von Gegenmacht und materiellen Zugewinnen erwiesen haben, insofern ist das Argument nicht ohne weiteres von der Hand zu
weisen. Allerdings haben sich solche Entwicklungen immer nur als Folge einer Mobilisierung der Mitgliedschaft und Koalitionen über die Gewerkschaft hinaus ergeben.
 Tatsächlich haben die CAW in der Vergangenheit ihr Bildungsprogramm auf die Mobilisierung ihrer Mitglieder
angelegt und sich in vielen sozialen Bewegungen engagiert. An den Protesten gegen die Tagung der Welthandelsorganisation in Seattle 1999 waren CAW-Aktivisten ebenso
maßgeblich beteiligt wie an den Aktionen gegen eine Freihandelszone von Alaska bis Feuerland.
Tatsächlich haben die CAW in der Vergangenheit ihr Bildungsprogramm auf die Mobilisierung ihrer Mitglieder
angelegt und sich in vielen sozialen Bewegungen engagiert. An den Protesten gegen die Tagung der Welthandelsorganisation in Seattle 1999 waren CAW-Aktivisten ebenso
maßgeblich beteiligt wie an den Aktionen gegen eine Freihandelszone von Alaska bis Feuerland.
 Auch in unzähligen lokalen Bündnissen haben sich die CAW immer wieder als eine Kraft des
„Social Movement Unionism” erwiesen. Darüber haben sie versucht, Beschäftigte auch außerhalb der Automobilindustrie zu organisieren. Da in Kanada
die Organisierung nach Berufszweigen, bestenfalls nach einzelnen Wirtschaftssektoren vorherrscht, sollte auf diese Weise eine effektivere Vertretung der gesamten kanadischen
Arbeiterklasse erreicht werden.
Auch in unzähligen lokalen Bündnissen haben sich die CAW immer wieder als eine Kraft des
„Social Movement Unionism” erwiesen. Darüber haben sie versucht, Beschäftigte auch außerhalb der Automobilindustrie zu organisieren. Da in Kanada
die Organisierung nach Berufszweigen, bestenfalls nach einzelnen Wirtschaftssektoren vorherrscht, sollte auf diese Weise eine effektivere Vertretung der gesamten kanadischen
Arbeiterklasse erreicht werden.
 Allerdings hat dieser Ansatz gewerkschaftlicher Organisierung und Mobilisierung in den letzten Jahren einen bitteren
Beigeschmack bekommen. Auf die Kritik neoliberaler Globalisierungsprojekte wie der WTO und regionaler Freihandelsabkommen folgten zunehmend Forderungen nach Marktabschottung
und Subventionen für die „Big Three” — General Motors, Ford und Chrysler. Ansätze, die kanadische Arbeiterklasse als Bestandteil einer internationalen
Arbeiterbewegung zu organisieren, wurden mehr und mehr von Appellen an Regierung und Verbraucher verdrängt. Die Regierung sollte die Gewerkschaft und die „Big
Three” zu einem korporatistischen Block gegen die asiatische und europäische Konkurrenz zusammenschließen; die Verbraucher wurden aufgefordert, „Cars
made in Canada” anstelle importierter Wagen zu kaufen.
Allerdings hat dieser Ansatz gewerkschaftlicher Organisierung und Mobilisierung in den letzten Jahren einen bitteren
Beigeschmack bekommen. Auf die Kritik neoliberaler Globalisierungsprojekte wie der WTO und regionaler Freihandelsabkommen folgten zunehmend Forderungen nach Marktabschottung
und Subventionen für die „Big Three” — General Motors, Ford und Chrysler. Ansätze, die kanadische Arbeiterklasse als Bestandteil einer internationalen
Arbeiterbewegung zu organisieren, wurden mehr und mehr von Appellen an Regierung und Verbraucher verdrängt. Die Regierung sollte die Gewerkschaft und die „Big
Three” zu einem korporatistischen Block gegen die asiatische und europäische Konkurrenz zusammenschließen; die Verbraucher wurden aufgefordert, „Cars
made in Canada” anstelle importierter Wagen zu kaufen.
 Darüber hinaus hatte sich die Organisierung von Beschäftigten außerhalb der Automobilbranche oft
genug darin erschöpft, anderen Gewerkschaften ihre Mitglieder abzuwerben. Für solche „feindlichen Übernahmen” wurden die CAW im Jahr 2000 sogar
vorübergehend aus dem Gewerkschaftsdachverband Canadian Labour Congress (CLC) ausgeschlossen. Dagegen blieben die Versuche, die kanadischen Werke asiatischer und
europäischer Autofirmen zu organisieren, bescheiden. Deren Konkurrenz hat die Entwicklung der CAW in Richtung Korporatismus und Protektionismus entscheidend beeinflusst.
Darüber hinaus hatte sich die Organisierung von Beschäftigten außerhalb der Automobilbranche oft
genug darin erschöpft, anderen Gewerkschaften ihre Mitglieder abzuwerben. Für solche „feindlichen Übernahmen” wurden die CAW im Jahr 2000 sogar
vorübergehend aus dem Gewerkschaftsdachverband Canadian Labour Congress (CLC) ausgeschlossen. Dagegen blieben die Versuche, die kanadischen Werke asiatischer und
europäischer Autofirmen zu organisieren, bescheiden. Deren Konkurrenz hat die Entwicklung der CAW in Richtung Korporatismus und Protektionismus entscheidend beeinflusst.
 Von den 60er Jahren bis heute ist der Marktanteil der Big Three in Kanada und den USA von über 90% auf gut
50% zurückgegangen. Der absolut und relativ steigende Absatz asiatischer und europäischer Firmen geht nicht nur auf Importe, sondern auch auf die Produktion in
nordamerikanischen Werken zurück. Diese tragen 25% zur gesamten Automobilproduktion auf dem Kontinent bei, beschäftigen allerdings nur 7% der Automobilarbeiter.
Von den 60er Jahren bis heute ist der Marktanteil der Big Three in Kanada und den USA von über 90% auf gut
50% zurückgegangen. Der absolut und relativ steigende Absatz asiatischer und europäischer Firmen geht nicht nur auf Importe, sondern auch auf die Produktion in
nordamerikanischen Werken zurück. Diese tragen 25% zur gesamten Automobilproduktion auf dem Kontinent bei, beschäftigen allerdings nur 7% der Automobilarbeiter.
 Der gemessen an der Wertschöpfung geringe Beschäftigungsanteil lässt sich nicht durch einen
Produktivitätsvorsprung asiatischer und europäischer Firmen erklären, sondern durch die deutlich geringere Fertigungstiefe in diesen Werken. Anders ausgedrückt:
Der Anteil der Zulieferer an der gesamten Wertschöpfung ist sehr viel höher als bei General Motors & Co. Deshalb hat die gewerkschaftliche Organisierung einer
großen Zulieferfirma wie Magna in der Tat entscheidende Bedeutung für die Zukunft der Gewerkschaften im Automobilsektor.
Der gemessen an der Wertschöpfung geringe Beschäftigungsanteil lässt sich nicht durch einen
Produktivitätsvorsprung asiatischer und europäischer Firmen erklären, sondern durch die deutlich geringere Fertigungstiefe in diesen Werken. Anders ausgedrückt:
Der Anteil der Zulieferer an der gesamten Wertschöpfung ist sehr viel höher als bei General Motors & Co. Deshalb hat die gewerkschaftliche Organisierung einer
großen Zulieferfirma wie Magna in der Tat entscheidende Bedeutung für die Zukunft der Gewerkschaften im Automobilsektor.
 Kritiker des CAW-Magna-Abkommens befürchten allerdings, dass Magna durch den wachsenden
Wertschöpfungsanteil der Zulieferer bald in der Lage sein könnte, auch die Endmontage im Auftrag von „Automobilmarken und -entwicklern” zu
übernehmen. Geschäftsmodelle, bei denen eine Firma sich nur um Entwicklung, Marketing und Vertrieb kümmert, die Produktion hingegen vollständig Zulieferern
überlässt, sind aus der Textil- und der Computerindustrie seit langem bekannt.
Kritiker des CAW-Magna-Abkommens befürchten allerdings, dass Magna durch den wachsenden
Wertschöpfungsanteil der Zulieferer bald in der Lage sein könnte, auch die Endmontage im Auftrag von „Automobilmarken und -entwicklern” zu
übernehmen. Geschäftsmodelle, bei denen eine Firma sich nur um Entwicklung, Marketing und Vertrieb kümmert, die Produktion hingegen vollständig Zulieferern
überlässt, sind aus der Textil- und der Computerindustrie seit langem bekannt.
 Sollte Magna seine Tätigkeit auf die Endproduktion ausweiten, könnten die mit der CAW ausgehandelten
Tarifstandards zur Norm auch für die Beschäftigten bei General Motors, Ford und Chrysler werden. Ansatzpunkte, um eine entsprechende Absenkung von Einkommen und
Gewerkschaftsrechten sowie schlechtere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, liefert der Automobilmarkt zur Genüge. Im Jahr 2005 stand einer weltweiten Produktion von 61 Millionen
Pkw eine Produktionskapazität von 82 Millionen gegenüber. Der jüngst von VW bekannt gegebene Beschluss, ein neues Werk in Tennessee zu bauen, zeigt, dass die
Konkurrenz auf dem Automobilmarkt weiterhin durch den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten ausgetragen wird.
Sollte Magna seine Tätigkeit auf die Endproduktion ausweiten, könnten die mit der CAW ausgehandelten
Tarifstandards zur Norm auch für die Beschäftigten bei General Motors, Ford und Chrysler werden. Ansatzpunkte, um eine entsprechende Absenkung von Einkommen und
Gewerkschaftsrechten sowie schlechtere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, liefert der Automobilmarkt zur Genüge. Im Jahr 2005 stand einer weltweiten Produktion von 61 Millionen
Pkw eine Produktionskapazität von 82 Millionen gegenüber. Der jüngst von VW bekannt gegebene Beschluss, ein neues Werk in Tennessee zu bauen, zeigt, dass die
Konkurrenz auf dem Automobilmarkt weiterhin durch den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten ausgetragen wird.
 Der von dieser Form des Konkurrenzkampfs ausgehende Druck, Kapazitäten und Arbeitsplätze an anderer
Stelle abzubauen bzw. den Ausbeutungsgrad für die verbleibenden Beschäftigten zu erhöhen, trifft Kanada gegenwärtig härter als die USA. Das liegt
einerseits daran, dass die WTO im Jahr 2001 den 1965 zwischen beiden Ländern abgeschlossenen „Autopakt” für illegal erklärt hat und weder die
amerikanische noch die kanadische Regierung sich genötigt sahen, dieser Entscheidung zu widersprechen. Der Autopakt garantierte kanadischen Werken der Big Three einen
bestimmten Anteil am nordamerikanischen Automobilmarkt und sicherte dadurch kanadische Autoexporte in die USA ab.
Der von dieser Form des Konkurrenzkampfs ausgehende Druck, Kapazitäten und Arbeitsplätze an anderer
Stelle abzubauen bzw. den Ausbeutungsgrad für die verbleibenden Beschäftigten zu erhöhen, trifft Kanada gegenwärtig härter als die USA. Das liegt
einerseits daran, dass die WTO im Jahr 2001 den 1965 zwischen beiden Ländern abgeschlossenen „Autopakt” für illegal erklärt hat und weder die
amerikanische noch die kanadische Regierung sich genötigt sahen, dieser Entscheidung zu widersprechen. Der Autopakt garantierte kanadischen Werken der Big Three einen
bestimmten Anteil am nordamerikanischen Automobilmarkt und sicherte dadurch kanadische Autoexporte in die USA ab.
 Der Wegfall politisch garantierter Marktanteile wurde sehr schnell zu einem Problem, weil nur ein Jahr später,
2002, eine massive Aufwertung des kanadischen gegenüber dem US-Dollar einsetzte, in deren Folge „Cars made in Canada” sich relativ zu solchen „made in
the US” erheblich verteuerten. Nur nebenbei sei erwähnt, dass die Aufwertung des kanadischen Dollars in erheblichem Maße auf steigende Ölexporte
zurückzuführen ist.
Der Wegfall politisch garantierter Marktanteile wurde sehr schnell zu einem Problem, weil nur ein Jahr später,
2002, eine massive Aufwertung des kanadischen gegenüber dem US-Dollar einsetzte, in deren Folge „Cars made in Canada” sich relativ zu solchen „made in
the US” erheblich verteuerten. Nur nebenbei sei erwähnt, dass die Aufwertung des kanadischen Dollars in erheblichem Maße auf steigende Ölexporte
zurückzuführen ist.
 Der Versuch, die kanadische Wirtschaft durch den Export von Fahrzeugen und Kraftstoff gleichermaßen
anzukurbeln, ist vorläufig gescheitert. Steigenden Exporterlösen aus dem Ölgeschäft steht eine Absatzkrise im Automobilsektor gegenüber. Unter diesen
Bedingungen dürften den CAW und ihren Mitgliedern weder Konzessionen an die Unternehmen noch Bitten um Regierungsintervention weiterhelfen. Allerdings bedürfte auch
eine Fortsetzung des Social Movement Unionism, der in den 90er Jahren durch günstige Wechselkurse und den damals noch bestehenden Autopakt begünstigt wurde, einer
neuen wirtschaftlichen Grundlage.
Der Versuch, die kanadische Wirtschaft durch den Export von Fahrzeugen und Kraftstoff gleichermaßen
anzukurbeln, ist vorläufig gescheitert. Steigenden Exporterlösen aus dem Ölgeschäft steht eine Absatzkrise im Automobilsektor gegenüber. Unter diesen
Bedingungen dürften den CAW und ihren Mitgliedern weder Konzessionen an die Unternehmen noch Bitten um Regierungsintervention weiterhelfen. Allerdings bedürfte auch
eine Fortsetzung des Social Movement Unionism, der in den 90er Jahren durch günstige Wechselkurse und den damals noch bestehenden Autopakt begünstigt wurde, einer
neuen wirtschaftlichen Grundlage.
Ich möchte die SoZ mal in der Hand halten
und bestelle eine kostenlose Probeausgabe oder ein Probeabo
|
|

|
|
Sozialistische Hefte
für Theorie und Praxis
Sonderausgabe der SoZ
42 Seiten, 5 Euro,
|
|
|
Der Stand der Dinge
Perry Anderson überblickt den westpolitischen Stand der Dinge
Gregory Albo untersucht den anhaltenden politischen Erfolg des Neoliberalismus und die Schwäche der Linken
Alfredo Saa-Fidho verdeutlicht die Unterschiede der keynsianischen und der marxistischen Kritik des Neoliberalismus
Ulrich Duchrow fragt nach den psychischen Mechanismen und Kosten des Neoliberlismus
Walter Benn Michaelis sieht in Barack Obama das neue Pin-Up des Neoliberalismus und zeigt, dass es nicht reicht, nur von Vielfalt zu reden
Christoph Jünke über Karl Liebknechts Aktualität
|
|

 Jahrelang bemühten sich die Canadian Auto Workers (CAW) darum, die kanadischen Betriebe von Magna
International, einem der weltgrößten Automobilzulieferer, gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifverträge auszuhandeln.
Jahrelang bemühten sich die Canadian Auto Workers (CAW) darum, die kanadischen Betriebe von Magna
International, einem der weltgrößten Automobilzulieferer, gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifverträge auszuhandeln.
 In Kanada, ebenso wie in anderen angelsächsischen Ländern, muss die Anerkennung von Gewerkschaften
und Tarifverträgen auf Betriebsebene errungen werden. Gegen eine strikt antigewerkschaftliche Unternehmensleitung konnte die CAW in diesem mühseligen
„Häuserkampf” — Magna beschäftigt in Kanada 18000 Arbeiter in 45 Niederlassungen — nur vereinzelte Erfolge erzielen. Umso
überraschter waren die CAW-Mitglieder und die kanadische Öffentlichkeit, als Magna-Chef Frank Stronach und CAW-Präsident Buzz Hargrove im Oktober 2007 einen
Vertrag vorstellten, der der Gewerkschaft erlaubt, pro Jahr fünf Magna-Betriebe zu organisieren. Nach neun Jahren wäre die CAW demnach in allen kanadischen Magna-
Werken vertreten.
In Kanada, ebenso wie in anderen angelsächsischen Ländern, muss die Anerkennung von Gewerkschaften
und Tarifverträgen auf Betriebsebene errungen werden. Gegen eine strikt antigewerkschaftliche Unternehmensleitung konnte die CAW in diesem mühseligen
„Häuserkampf” — Magna beschäftigt in Kanada 18000 Arbeiter in 45 Niederlassungen — nur vereinzelte Erfolge erzielen. Umso
überraschter waren die CAW-Mitglieder und die kanadische Öffentlichkeit, als Magna-Chef Frank Stronach und CAW-Präsident Buzz Hargrove im Oktober 2007 einen
Vertrag vorstellten, der der Gewerkschaft erlaubt, pro Jahr fünf Magna-Betriebe zu organisieren. Nach neun Jahren wäre die CAW demnach in allen kanadischen Magna-
Werken vertreten.
 Bereits einen Monat später wurde für die Beschäftigten des Magna-Werks Windsor Modules ein
Tarifvertrag abgeschlossen, der bei einer Laufzeit von drei Jahren eine sofortige Lohnerhöhung von 3 Dollar pro Stunde, prozentuale Erhöhungen in den Folgejahren sowie
Arbeitsplatzgarantien und bezahlte Fortbildungen enthält. Im Vergleich zu den Tarifabschlüssen in anderen Betrieben und Wirtschaftsbereichen kann sich dieser Abschluss sehen
lassen — umso mehr, wenn man die aktuelle Krise der kanadischen und weltweiten Automobilindustrie berücksichtigt. Es sei nur daran erinnert, dass Ende 2005 eine andere
Zulieferfirma, Delphi, Konkurs angemeldet hat, um die zu zahlenden Löhne um zwei Drittel (!) zu senken, und in der Folge massiv Stellen abgebaut hat.
Bereits einen Monat später wurde für die Beschäftigten des Magna-Werks Windsor Modules ein
Tarifvertrag abgeschlossen, der bei einer Laufzeit von drei Jahren eine sofortige Lohnerhöhung von 3 Dollar pro Stunde, prozentuale Erhöhungen in den Folgejahren sowie
Arbeitsplatzgarantien und bezahlte Fortbildungen enthält. Im Vergleich zu den Tarifabschlüssen in anderen Betrieben und Wirtschaftsbereichen kann sich dieser Abschluss sehen
lassen — umso mehr, wenn man die aktuelle Krise der kanadischen und weltweiten Automobilindustrie berücksichtigt. Es sei nur daran erinnert, dass Ende 2005 eine andere
Zulieferfirma, Delphi, Konkurs angemeldet hat, um die zu zahlenden Löhne um zwei Drittel (!) zu senken, und in der Folge massiv Stellen abgebaut hat.
 Dennoch wurde das CAW-Magna-Abkommen heftig kritisiert. Insbesondere ältere Gewerkschaftsaktive, die die
CAW seit 1985 als eine kämpferische Gewerkschaft in Abgrenzung von den sozialpartnerschaflichen United Auto Workers (UAW) aufgebaut haben, sehen in dem Abkommen mit
Magna keinen Durchbruch, sondern einen Kurswechsel der Gewerkschaftsführung in Richtung Sozialpartnerschaft und „Concession Bargaining”
Dennoch wurde das CAW-Magna-Abkommen heftig kritisiert. Insbesondere ältere Gewerkschaftsaktive, die die
CAW seit 1985 als eine kämpferische Gewerkschaft in Abgrenzung von den sozialpartnerschaflichen United Auto Workers (UAW) aufgebaut haben, sehen in dem Abkommen mit
Magna keinen Durchbruch, sondern einen Kurswechsel der Gewerkschaftsführung in Richtung Sozialpartnerschaft und „Concession Bargaining”
 Drei Punkte stießen auf besondere Ablehnung:
Drei Punkte stießen auf besondere Ablehnung:
 — Erstens erklären sich die CAW damit einverstanden, dass Magna-Beschäftigte nicht streiken
dürfen.
— Erstens erklären sich die CAW damit einverstanden, dass Magna-Beschäftigte nicht streiken
dürfen.
 — Zweitens sollen die Belegschaftsvertreter nicht von den Gewerkschaftsmitgliedern gewählt, sondern von
einem aus Unternehmens- und Gewerkschaftsvertretern zusammengesetzten Komitee ernannt werden.
— Zweitens sollen die Belegschaftsvertreter nicht von den Gewerkschaftsmitgliedern gewählt, sondern von
einem aus Unternehmens- und Gewerkschaftsvertretern zusammengesetzten Komitee ernannt werden.
 — Drittens sind Gewerkschaft und Belegschaftsvertreter den Unternehmenszielen verpflichtet; Aktivitäten,
die die Belegschaften politisieren und in Gegensatz zur Unternehmensleitung bringen können, sind untersagt.
— Drittens sind Gewerkschaft und Belegschaftsvertreter den Unternehmenszielen verpflichtet; Aktivitäten,
die die Belegschaften politisieren und in Gegensatz zur Unternehmensleitung bringen können, sind untersagt.
 Unter diesen Bedingungen, so lautet die Kritik, können die Beschäftigten bei Magna ihre Einkommens- und
Arbeitsbedingungen trotz formaler Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht verbessern. Darüber hinaus würden Unternehmen, in denen Gewerkschaftsmitglieder gegenwärtig
deutlich mehr Rechte und höhere soziale Standards haben, mit Verweis auf Magna in Zukunft deutliche Zugeständnisse bei Einkommen und Arbeitsbedingungen verlangen.
Kurz, statt eines Einbruchs in bislang gewerkschaftsfreies Terrain, wie er von Buzz Hargrove gefeiert wird, sehen Kritiker im CAW-Magna-Abkommen ein Signal, unter formaler
Anerkennung der Gewerkschaften materielle Zugeständnisse von der Mitgliedschaft zu fordern.
Unter diesen Bedingungen, so lautet die Kritik, können die Beschäftigten bei Magna ihre Einkommens- und
Arbeitsbedingungen trotz formaler Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht verbessern. Darüber hinaus würden Unternehmen, in denen Gewerkschaftsmitglieder gegenwärtig
deutlich mehr Rechte und höhere soziale Standards haben, mit Verweis auf Magna in Zukunft deutliche Zugeständnisse bei Einkommen und Arbeitsbedingungen verlangen.
Kurz, statt eines Einbruchs in bislang gewerkschaftsfreies Terrain, wie er von Buzz Hargrove gefeiert wird, sehen Kritiker im CAW-Magna-Abkommen ein Signal, unter formaler
Anerkennung der Gewerkschaften materielle Zugeständnisse von der Mitgliedschaft zu fordern.
 Dieser Kritik hält Hargrove entgegen, dass es zunächst einmal darum gegangen sei, bei Magna einen
Fuß in die Tür zu bekommen. Sobald die formale Anerkennung der Gewerkschaft erreicht sei, könnten nicht nur schrittweise bessere materielle Bedingungen durchgesetzt,
sondern schließlich auch volle gewerkschaftliche Rechte inkl. Streikrecht und Wahl von Belegschaftsvertretern durchgesetzt werden.
Dieser Kritik hält Hargrove entgegen, dass es zunächst einmal darum gegangen sei, bei Magna einen
Fuß in die Tür zu bekommen. Sobald die formale Anerkennung der Gewerkschaft erreicht sei, könnten nicht nur schrittweise bessere materielle Bedingungen durchgesetzt,
sondern schließlich auch volle gewerkschaftliche Rechte inkl. Streikrecht und Wahl von Belegschaftsvertretern durchgesetzt werden.
 In der Geschichte der Arbeiterbewegung hat es immer wieder Fälle gegeben, in denen sich bescheidene
Anfänge formeller Anerkennung als Ausgangspunkt von Gegenmacht und materiellen Zugewinnen erwiesen haben, insofern ist das Argument nicht ohne weiteres von der Hand zu
weisen. Allerdings haben sich solche Entwicklungen immer nur als Folge einer Mobilisierung der Mitgliedschaft und Koalitionen über die Gewerkschaft hinaus ergeben.
In der Geschichte der Arbeiterbewegung hat es immer wieder Fälle gegeben, in denen sich bescheidene
Anfänge formeller Anerkennung als Ausgangspunkt von Gegenmacht und materiellen Zugewinnen erwiesen haben, insofern ist das Argument nicht ohne weiteres von der Hand zu
weisen. Allerdings haben sich solche Entwicklungen immer nur als Folge einer Mobilisierung der Mitgliedschaft und Koalitionen über die Gewerkschaft hinaus ergeben.
 Tatsächlich haben die CAW in der Vergangenheit ihr Bildungsprogramm auf die Mobilisierung ihrer Mitglieder
angelegt und sich in vielen sozialen Bewegungen engagiert. An den Protesten gegen die Tagung der Welthandelsorganisation in Seattle 1999 waren CAW-Aktivisten ebenso
maßgeblich beteiligt wie an den Aktionen gegen eine Freihandelszone von Alaska bis Feuerland.
Tatsächlich haben die CAW in der Vergangenheit ihr Bildungsprogramm auf die Mobilisierung ihrer Mitglieder
angelegt und sich in vielen sozialen Bewegungen engagiert. An den Protesten gegen die Tagung der Welthandelsorganisation in Seattle 1999 waren CAW-Aktivisten ebenso
maßgeblich beteiligt wie an den Aktionen gegen eine Freihandelszone von Alaska bis Feuerland.
 Auch in unzähligen lokalen Bündnissen haben sich die CAW immer wieder als eine Kraft des
„Social Movement Unionism” erwiesen. Darüber haben sie versucht, Beschäftigte auch außerhalb der Automobilindustrie zu organisieren. Da in Kanada
die Organisierung nach Berufszweigen, bestenfalls nach einzelnen Wirtschaftssektoren vorherrscht, sollte auf diese Weise eine effektivere Vertretung der gesamten kanadischen
Arbeiterklasse erreicht werden.
Auch in unzähligen lokalen Bündnissen haben sich die CAW immer wieder als eine Kraft des
„Social Movement Unionism” erwiesen. Darüber haben sie versucht, Beschäftigte auch außerhalb der Automobilindustrie zu organisieren. Da in Kanada
die Organisierung nach Berufszweigen, bestenfalls nach einzelnen Wirtschaftssektoren vorherrscht, sollte auf diese Weise eine effektivere Vertretung der gesamten kanadischen
Arbeiterklasse erreicht werden.
 Allerdings hat dieser Ansatz gewerkschaftlicher Organisierung und Mobilisierung in den letzten Jahren einen bitteren
Beigeschmack bekommen. Auf die Kritik neoliberaler Globalisierungsprojekte wie der WTO und regionaler Freihandelsabkommen folgten zunehmend Forderungen nach Marktabschottung
und Subventionen für die „Big Three” — General Motors, Ford und Chrysler. Ansätze, die kanadische Arbeiterklasse als Bestandteil einer internationalen
Arbeiterbewegung zu organisieren, wurden mehr und mehr von Appellen an Regierung und Verbraucher verdrängt. Die Regierung sollte die Gewerkschaft und die „Big
Three” zu einem korporatistischen Block gegen die asiatische und europäische Konkurrenz zusammenschließen; die Verbraucher wurden aufgefordert, „Cars
made in Canada” anstelle importierter Wagen zu kaufen.
Allerdings hat dieser Ansatz gewerkschaftlicher Organisierung und Mobilisierung in den letzten Jahren einen bitteren
Beigeschmack bekommen. Auf die Kritik neoliberaler Globalisierungsprojekte wie der WTO und regionaler Freihandelsabkommen folgten zunehmend Forderungen nach Marktabschottung
und Subventionen für die „Big Three” — General Motors, Ford und Chrysler. Ansätze, die kanadische Arbeiterklasse als Bestandteil einer internationalen
Arbeiterbewegung zu organisieren, wurden mehr und mehr von Appellen an Regierung und Verbraucher verdrängt. Die Regierung sollte die Gewerkschaft und die „Big
Three” zu einem korporatistischen Block gegen die asiatische und europäische Konkurrenz zusammenschließen; die Verbraucher wurden aufgefordert, „Cars
made in Canada” anstelle importierter Wagen zu kaufen.
 Darüber hinaus hatte sich die Organisierung von Beschäftigten außerhalb der Automobilbranche oft
genug darin erschöpft, anderen Gewerkschaften ihre Mitglieder abzuwerben. Für solche „feindlichen Übernahmen” wurden die CAW im Jahr 2000 sogar
vorübergehend aus dem Gewerkschaftsdachverband Canadian Labour Congress (CLC) ausgeschlossen. Dagegen blieben die Versuche, die kanadischen Werke asiatischer und
europäischer Autofirmen zu organisieren, bescheiden. Deren Konkurrenz hat die Entwicklung der CAW in Richtung Korporatismus und Protektionismus entscheidend beeinflusst.
Darüber hinaus hatte sich die Organisierung von Beschäftigten außerhalb der Automobilbranche oft
genug darin erschöpft, anderen Gewerkschaften ihre Mitglieder abzuwerben. Für solche „feindlichen Übernahmen” wurden die CAW im Jahr 2000 sogar
vorübergehend aus dem Gewerkschaftsdachverband Canadian Labour Congress (CLC) ausgeschlossen. Dagegen blieben die Versuche, die kanadischen Werke asiatischer und
europäischer Autofirmen zu organisieren, bescheiden. Deren Konkurrenz hat die Entwicklung der CAW in Richtung Korporatismus und Protektionismus entscheidend beeinflusst.
 Von den 60er Jahren bis heute ist der Marktanteil der Big Three in Kanada und den USA von über 90% auf gut
50% zurückgegangen. Der absolut und relativ steigende Absatz asiatischer und europäischer Firmen geht nicht nur auf Importe, sondern auch auf die Produktion in
nordamerikanischen Werken zurück. Diese tragen 25% zur gesamten Automobilproduktion auf dem Kontinent bei, beschäftigen allerdings nur 7% der Automobilarbeiter.
Von den 60er Jahren bis heute ist der Marktanteil der Big Three in Kanada und den USA von über 90% auf gut
50% zurückgegangen. Der absolut und relativ steigende Absatz asiatischer und europäischer Firmen geht nicht nur auf Importe, sondern auch auf die Produktion in
nordamerikanischen Werken zurück. Diese tragen 25% zur gesamten Automobilproduktion auf dem Kontinent bei, beschäftigen allerdings nur 7% der Automobilarbeiter.
 Der gemessen an der Wertschöpfung geringe Beschäftigungsanteil lässt sich nicht durch einen
Produktivitätsvorsprung asiatischer und europäischer Firmen erklären, sondern durch die deutlich geringere Fertigungstiefe in diesen Werken. Anders ausgedrückt:
Der Anteil der Zulieferer an der gesamten Wertschöpfung ist sehr viel höher als bei General Motors & Co. Deshalb hat die gewerkschaftliche Organisierung einer
großen Zulieferfirma wie Magna in der Tat entscheidende Bedeutung für die Zukunft der Gewerkschaften im Automobilsektor.
Der gemessen an der Wertschöpfung geringe Beschäftigungsanteil lässt sich nicht durch einen
Produktivitätsvorsprung asiatischer und europäischer Firmen erklären, sondern durch die deutlich geringere Fertigungstiefe in diesen Werken. Anders ausgedrückt:
Der Anteil der Zulieferer an der gesamten Wertschöpfung ist sehr viel höher als bei General Motors & Co. Deshalb hat die gewerkschaftliche Organisierung einer
großen Zulieferfirma wie Magna in der Tat entscheidende Bedeutung für die Zukunft der Gewerkschaften im Automobilsektor.
 Kritiker des CAW-Magna-Abkommens befürchten allerdings, dass Magna durch den wachsenden
Wertschöpfungsanteil der Zulieferer bald in der Lage sein könnte, auch die Endmontage im Auftrag von „Automobilmarken und -entwicklern” zu
übernehmen. Geschäftsmodelle, bei denen eine Firma sich nur um Entwicklung, Marketing und Vertrieb kümmert, die Produktion hingegen vollständig Zulieferern
überlässt, sind aus der Textil- und der Computerindustrie seit langem bekannt.
Kritiker des CAW-Magna-Abkommens befürchten allerdings, dass Magna durch den wachsenden
Wertschöpfungsanteil der Zulieferer bald in der Lage sein könnte, auch die Endmontage im Auftrag von „Automobilmarken und -entwicklern” zu
übernehmen. Geschäftsmodelle, bei denen eine Firma sich nur um Entwicklung, Marketing und Vertrieb kümmert, die Produktion hingegen vollständig Zulieferern
überlässt, sind aus der Textil- und der Computerindustrie seit langem bekannt.
 Sollte Magna seine Tätigkeit auf die Endproduktion ausweiten, könnten die mit der CAW ausgehandelten
Tarifstandards zur Norm auch für die Beschäftigten bei General Motors, Ford und Chrysler werden. Ansatzpunkte, um eine entsprechende Absenkung von Einkommen und
Gewerkschaftsrechten sowie schlechtere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, liefert der Automobilmarkt zur Genüge. Im Jahr 2005 stand einer weltweiten Produktion von 61 Millionen
Pkw eine Produktionskapazität von 82 Millionen gegenüber. Der jüngst von VW bekannt gegebene Beschluss, ein neues Werk in Tennessee zu bauen, zeigt, dass die
Konkurrenz auf dem Automobilmarkt weiterhin durch den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten ausgetragen wird.
Sollte Magna seine Tätigkeit auf die Endproduktion ausweiten, könnten die mit der CAW ausgehandelten
Tarifstandards zur Norm auch für die Beschäftigten bei General Motors, Ford und Chrysler werden. Ansatzpunkte, um eine entsprechende Absenkung von Einkommen und
Gewerkschaftsrechten sowie schlechtere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, liefert der Automobilmarkt zur Genüge. Im Jahr 2005 stand einer weltweiten Produktion von 61 Millionen
Pkw eine Produktionskapazität von 82 Millionen gegenüber. Der jüngst von VW bekannt gegebene Beschluss, ein neues Werk in Tennessee zu bauen, zeigt, dass die
Konkurrenz auf dem Automobilmarkt weiterhin durch den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten ausgetragen wird.
 Der von dieser Form des Konkurrenzkampfs ausgehende Druck, Kapazitäten und Arbeitsplätze an anderer
Stelle abzubauen bzw. den Ausbeutungsgrad für die verbleibenden Beschäftigten zu erhöhen, trifft Kanada gegenwärtig härter als die USA. Das liegt
einerseits daran, dass die WTO im Jahr 2001 den 1965 zwischen beiden Ländern abgeschlossenen „Autopakt” für illegal erklärt hat und weder die
amerikanische noch die kanadische Regierung sich genötigt sahen, dieser Entscheidung zu widersprechen. Der Autopakt garantierte kanadischen Werken der Big Three einen
bestimmten Anteil am nordamerikanischen Automobilmarkt und sicherte dadurch kanadische Autoexporte in die USA ab.
Der von dieser Form des Konkurrenzkampfs ausgehende Druck, Kapazitäten und Arbeitsplätze an anderer
Stelle abzubauen bzw. den Ausbeutungsgrad für die verbleibenden Beschäftigten zu erhöhen, trifft Kanada gegenwärtig härter als die USA. Das liegt
einerseits daran, dass die WTO im Jahr 2001 den 1965 zwischen beiden Ländern abgeschlossenen „Autopakt” für illegal erklärt hat und weder die
amerikanische noch die kanadische Regierung sich genötigt sahen, dieser Entscheidung zu widersprechen. Der Autopakt garantierte kanadischen Werken der Big Three einen
bestimmten Anteil am nordamerikanischen Automobilmarkt und sicherte dadurch kanadische Autoexporte in die USA ab.
 Der Wegfall politisch garantierter Marktanteile wurde sehr schnell zu einem Problem, weil nur ein Jahr später,
2002, eine massive Aufwertung des kanadischen gegenüber dem US-Dollar einsetzte, in deren Folge „Cars made in Canada” sich relativ zu solchen „made in
the US” erheblich verteuerten. Nur nebenbei sei erwähnt, dass die Aufwertung des kanadischen Dollars in erheblichem Maße auf steigende Ölexporte
zurückzuführen ist.
Der Wegfall politisch garantierter Marktanteile wurde sehr schnell zu einem Problem, weil nur ein Jahr später,
2002, eine massive Aufwertung des kanadischen gegenüber dem US-Dollar einsetzte, in deren Folge „Cars made in Canada” sich relativ zu solchen „made in
the US” erheblich verteuerten. Nur nebenbei sei erwähnt, dass die Aufwertung des kanadischen Dollars in erheblichem Maße auf steigende Ölexporte
zurückzuführen ist.
 Der Versuch, die kanadische Wirtschaft durch den Export von Fahrzeugen und Kraftstoff gleichermaßen
anzukurbeln, ist vorläufig gescheitert. Steigenden Exporterlösen aus dem Ölgeschäft steht eine Absatzkrise im Automobilsektor gegenüber. Unter diesen
Bedingungen dürften den CAW und ihren Mitgliedern weder Konzessionen an die Unternehmen noch Bitten um Regierungsintervention weiterhelfen. Allerdings bedürfte auch
eine Fortsetzung des Social Movement Unionism, der in den 90er Jahren durch günstige Wechselkurse und den damals noch bestehenden Autopakt begünstigt wurde, einer
neuen wirtschaftlichen Grundlage.
Der Versuch, die kanadische Wirtschaft durch den Export von Fahrzeugen und Kraftstoff gleichermaßen
anzukurbeln, ist vorläufig gescheitert. Steigenden Exporterlösen aus dem Ölgeschäft steht eine Absatzkrise im Automobilsektor gegenüber. Unter diesen
Bedingungen dürften den CAW und ihren Mitgliedern weder Konzessionen an die Unternehmen noch Bitten um Regierungsintervention weiterhelfen. Allerdings bedürfte auch
eine Fortsetzung des Social Movement Unionism, der in den 90er Jahren durch günstige Wechselkurse und den damals noch bestehenden Autopakt begünstigt wurde, einer
neuen wirtschaftlichen Grundlage.
