| SoZ - Sozialistische Zeitung |
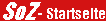 SoZ - Sozialistische Zeitung, Dezember 2008, Seite 12
SoZ - Sozialistische Zeitung, Dezember 2008, Seite 12
Weder Keynes noch Sozialismus
Die Finanzkrise und ihre Auswirkung auf die US-Hegemonie.
INGO SCHMIDT vergleicht die Krisen 1930, 1970, 2008
Die Finanzkrise hat den Glauben an die Fähigkeit der USA,
Vermögen und Profite zu schützen, erschüttert. Doch zum Pentagon-Wall-Street-
Kapitalismus gibt es noch keine Alternative.
 Boom oder Pleite, die Wall
Street kann einen beschäftigen. Jedermann diskutiert dieser Tage über das 700
Milliarden Dollar schwere Rettungspaket der US-Regierung. Nach der Pleite der Investmentbank
Lehman Brothers ist die große Frage: Wer kommt als nächstes?
Boom oder Pleite, die Wall
Street kann einen beschäftigen. Jedermann diskutiert dieser Tage über das 700
Milliarden Dollar schwere Rettungspaket der US-Regierung. Nach der Pleite der Investmentbank
Lehman Brothers ist die große Frage: Wer kommt als nächstes?
 Letzten Monat wurde
darüber spekuliert, ob der Verfall der Ölpreise und ein steigender US-Dollar wieder
einen neuen Boom anzeigen. Letztes Jahr waren wir schon einmal soweit: Ängste, die
Turbulenzen an den Finanzmärkten könnten die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft in
die Rezession treiben. Im Verlauf des Jahres erreichte der Ölpreis Rekordhöhen (1,44
US-Dollar im Juli), der US-Dollar Rekordtiefen (1,60 Dollar für 1 Euro im April) und das
Flaggschiff des US-Finanzkapitals, die Investmentbanken, versank.
Letzten Monat wurde
darüber spekuliert, ob der Verfall der Ölpreise und ein steigender US-Dollar wieder
einen neuen Boom anzeigen. Letztes Jahr waren wir schon einmal soweit: Ängste, die
Turbulenzen an den Finanzmärkten könnten die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft in
die Rezession treiben. Im Verlauf des Jahres erreichte der Ölpreis Rekordhöhen (1,44
US-Dollar im Juli), der US-Dollar Rekordtiefen (1,60 Dollar für 1 Euro im April) und das
Flaggschiff des US-Finanzkapitals, die Investmentbanken, versank.
 Bear Stearns und Merrill Lynch
wurden jeweils von JP Morgan Chase und der Bank of America übernommen. Die beiden
Letzteren sind Geschäftsbanken, keine Investmentbanken. Das bedeutet, dass sie der
Bankenaufsicht unterstehen und sich bei der Zentralbank refinanzieren können, statt ihre
Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt auszugeben und zu verkaufen, wie Investmentbanken. Auch
Goldman Sachs und Morgan Stanley sind unter den Schutz der US-Notenbank gekrochen, nachdem
Lehman Brothers schutzlos auf dem Kapitalmarkt untergegangen ist.
Bear Stearns und Merrill Lynch
wurden jeweils von JP Morgan Chase und der Bank of America übernommen. Die beiden
Letzteren sind Geschäftsbanken, keine Investmentbanken. Das bedeutet, dass sie der
Bankenaufsicht unterstehen und sich bei der Zentralbank refinanzieren können, statt ihre
Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt auszugeben und zu verkaufen, wie Investmentbanken. Auch
Goldman Sachs und Morgan Stanley sind unter den Schutz der US-Notenbank gekrochen, nachdem
Lehman Brothers schutzlos auf dem Kapitalmarkt untergegangen ist.
 Der Untergang der
Investmentbanken in den USA und im weiteren Sinne die globale Instabilität der
Finanzmärkte haben in Washington, Frankfurt, Tokyo und London zu Interventionen der
Regierungen und der Zentralbanken geführt. Umfangreiche Rettungspakete und staatliche
Übernahmen von Finanz- und Hypothekeninstituten — wovon Fannie Mae, Freddie Mac und
AIG nur die prominentesten, aber längst nicht die einzigen sind — provozierten
zusammen mit Konjunkturpaketen verärgerte Kommentare bei Marktkonservativen, die die USA
schon auf dem Marsch in den Sozialismus witterten. Diese Leute müssen es wirklich schwer
haben.
Der Untergang der
Investmentbanken in den USA und im weiteren Sinne die globale Instabilität der
Finanzmärkte haben in Washington, Frankfurt, Tokyo und London zu Interventionen der
Regierungen und der Zentralbanken geführt. Umfangreiche Rettungspakete und staatliche
Übernahmen von Finanz- und Hypothekeninstituten — wovon Fannie Mae, Freddie Mac und
AIG nur die prominentesten, aber längst nicht die einzigen sind — provozierten
zusammen mit Konjunkturpaketen verärgerte Kommentare bei Marktkonservativen, die die USA
schon auf dem Marsch in den Sozialismus witterten. Diese Leute müssen es wirklich schwer
haben.
Update des Neoliberalismus
In den späten 40er Jahren rüttelte der führende Kopf der Neoklassik, Joseph
Schumpeter, die American Economic Association wach, als er die Wirtschaft auf einem
„unaufhaltsamen Marsch in den Sozialismus” sah. Milton Friedman sammelte einige
von Schumpeters Jüngern zusammen und machte aus ihnen Kader, die später, in den 70er
Jahren, zur Avantgarde des neoliberalen Projekts wurden; dieses sollte eine Kehrtwende auf dem
Weg in die sozialistische Leibeigenschaft einleiten. Die Kader sollten die Menschheit
zurück ins Reich der Freiheit führen, zu Unternehmergeist, Privateigentum und
Profit.
 Neben vielen anderen
führenden Vertretern aus Politik und Wirtschaft wurden auch Hank Paulson, Finanzminister
unter George W. Bush und Architekt des 700-Milliarden-Dollar-Rettungspakets, und Robert Rubin,
Finanzminister unter Clinton und einer der zentralen Wirtschaftsberater von Barack Obama, zu
Mitgliedern dieser Avantgarde erzogen.
Neben vielen anderen
führenden Vertretern aus Politik und Wirtschaft wurden auch Hank Paulson, Finanzminister
unter George W. Bush und Architekt des 700-Milliarden-Dollar-Rettungspakets, und Robert Rubin,
Finanzminister unter Clinton und einer der zentralen Wirtschaftsberater von Barack Obama, zu
Mitgliedern dieser Avantgarde erzogen.
 Rubin machte 1960 seinen
Wirtschaftsabschluss in Harvard, bevor er eine Karriere als Wall-Street-Banker und Politiker
startete. Paulson verfehlte eine solide neoliberale Erziehung, weil er 1968 seinen BA in
Englisch am Dartmount College machte, aber er folgte Rubin dann in seiner Doppelkarriere als
Wall-Street-Banker und Politiker. Biografien wie diese sind heutzutage in der politischen
Klasse recht häufig.
Rubin machte 1960 seinen
Wirtschaftsabschluss in Harvard, bevor er eine Karriere als Wall-Street-Banker und Politiker
startete. Paulson verfehlte eine solide neoliberale Erziehung, weil er 1968 seinen BA in
Englisch am Dartmount College machte, aber er folgte Rubin dann in seiner Doppelkarriere als
Wall-Street-Banker und Politiker. Biografien wie diese sind heutzutage in der politischen
Klasse recht häufig.
 Die entscheidende Frage aber
ist: Was hat diese Charaktermasken der neoliberalen Kapitalismus dazu bewogen, zum
Staatsinterventionismus zu konvertieren? Sind sie Notenbankchef Ben Bernanke zum Opfer
gefallen, der, statt der Wall Street als Mann der Praxis zu dienen, lange Zeit seiner Karriere
damit verbracht hat, an der Stanford und an der Princeton Universität die Große
Depression der 30er Jahre zu studieren, bevor er Gouverneur und später Chef der Fed
wurde? Hat das Selbstvertrauen der Konservativen und Neoliberalen unter der aktuellen Krise so
sehr gelitten, dass sie verzweifelt nach Bernankes neokeynesianischem Strohhalm greifen?
Die entscheidende Frage aber
ist: Was hat diese Charaktermasken der neoliberalen Kapitalismus dazu bewogen, zum
Staatsinterventionismus zu konvertieren? Sind sie Notenbankchef Ben Bernanke zum Opfer
gefallen, der, statt der Wall Street als Mann der Praxis zu dienen, lange Zeit seiner Karriere
damit verbracht hat, an der Stanford und an der Princeton Universität die Große
Depression der 30er Jahre zu studieren, bevor er Gouverneur und später Chef der Fed
wurde? Hat das Selbstvertrauen der Konservativen und Neoliberalen unter der aktuellen Krise so
sehr gelitten, dass sie verzweifelt nach Bernankes neokeynesianischem Strohhalm greifen?
 Wahrscheinlich nicht. Als
akademische Modeströmung der letzten zwei Jahrzehnte hat der Neokeynesianismus der
neoliberalen Wirtschaftslehre ein Update verpasst und sie von der naiven Version der
„perfekten Information” zu einer realistischeren Variante weiterentwickelt, die
akzeptiert, dass Marktagenten über unvollständige und ungleich verteilte
Informationen verfügen. Diese Art Denken wurde in der Hoch-Zeit des neoliberalen
Kapitalismus, den 90er Jahren unter Clinton, zur wirtschaftspolitischen Lehrmeinung.
Wahrscheinlich nicht. Als
akademische Modeströmung der letzten zwei Jahrzehnte hat der Neokeynesianismus der
neoliberalen Wirtschaftslehre ein Update verpasst und sie von der naiven Version der
„perfekten Information” zu einer realistischeren Variante weiterentwickelt, die
akzeptiert, dass Marktagenten über unvollständige und ungleich verteilte
Informationen verfügen. Diese Art Denken wurde in der Hoch-Zeit des neoliberalen
Kapitalismus, den 90er Jahren unter Clinton, zur wirtschaftspolitischen Lehrmeinung.
 In den 90ern avancierte Josef
Stiglitz, der prominenteste Vertreter des Neokeynesianismus, zuerst zum Chefberater Clintons
in Wirtschaftsfragen, danach zum Chefökonom der Weltbank. Erst da begann er, die
neokeynesianische Wirtschaftslehre mit sozialdemokratischen politischen Vorstellungen zu
vermischen, was ihn alsbald seinen Job kostete. Der Neokeynesianismus hatte sich einen festen
Platz als die geeignetste Variante neoliberaler Politik erobert.
In den 90ern avancierte Josef
Stiglitz, der prominenteste Vertreter des Neokeynesianismus, zuerst zum Chefberater Clintons
in Wirtschaftsfragen, danach zum Chefökonom der Weltbank. Erst da begann er, die
neokeynesianische Wirtschaftslehre mit sozialdemokratischen politischen Vorstellungen zu
vermischen, was ihn alsbald seinen Job kostete. Der Neokeynesianismus hatte sich einen festen
Platz als die geeignetste Variante neoliberaler Politik erobert.
 Auch Lawrence Summer, Rubins
Nachfolger als Finanzminister unter Clinton und die treibende Kraft hinter Stiglitz‘
Entfernung aus der Weltbank, und Greg Mankiw, von 2003 bis 2005 Chefberater von Bush in
Wirtschaftsfragen, schlossen sich der neokeynesianischen Linie des Neoliberalismus an.
Auch Lawrence Summer, Rubins
Nachfolger als Finanzminister unter Clinton und die treibende Kraft hinter Stiglitz‘
Entfernung aus der Weltbank, und Greg Mankiw, von 2003 bis 2005 Chefberater von Bush in
Wirtschaftsfragen, schlossen sich der neokeynesianischen Linie des Neoliberalismus an.
Marsch in den Sozialismus?
Uneingestanden haben hart gesottene Konservative Angst davor, dass der Neoliberalismus,
nachdem er seinen langjährigen Rivalen Keynes auf einen unteren Rang in der
intellektuellen Welt verwiesen hat, dazu beigetragen hat, dass Sozialismus als die einzige
machbare politische Alternative in Zeiten schwerer Krise übrig bleibt. Sozialisten mag
das überraschen. Viele Sozialisten sind kaum mit der Analyse des Aufstiegs der
neoliberalen Hegemonie und einer transnationalen kapitalistischen Klasse fertig geworden und
haben sich gerade zur Schlussfolgerung vorgearbeitet, dass das Finanzkapital dominiert. Und
jetzt bricht dieser allmächtige historische Block schon wieder weg? Gibt es da nicht gute
Gründe anzunehmen, dass die konservativen Befürchtungen von einem Ende des
Neoliberalismus weit übertrieben sind?
 Nicht unbedingt. Finanzkrisen
haben die Wall Street 1987, 1990, 1998 und 2001—2003 erschüttert. Nur die Krisen
von 1990 und 2001 waren von einer Rezession begleitet. Verglichen mit den tiefen Krisen, die
fast jeden anderen Teil der Welt seit dem Aufstieg des Neoliberalismus erschüttert haben,
hatten die USA, Kanada und Westeuropa eine ziemlich ruhige Zeit.
Nicht unbedingt. Finanzkrisen
haben die Wall Street 1987, 1990, 1998 und 2001—2003 erschüttert. Nur die Krisen
von 1990 und 2001 waren von einer Rezession begleitet. Verglichen mit den tiefen Krisen, die
fast jeden anderen Teil der Welt seit dem Aufstieg des Neoliberalismus erschüttert haben,
hatten die USA, Kanada und Westeuropa eine ziemlich ruhige Zeit.
 Kehrt Schumpeters
Schreckgespenst — damals die Hoffnung der Sozialisten — von einem Marsch in den
Sozialismus zurück? Oder erleben wir eine neue Runde der „kreativen
Zerstörung”, in der Schumpeter das innovative Bewegungsgesetz der Marktwirtschaft
sah?
Kehrt Schumpeters
Schreckgespenst — damals die Hoffnung der Sozialisten — von einem Marsch in den
Sozialismus zurück? Oder erleben wir eine neue Runde der „kreativen
Zerstörung”, in der Schumpeter das innovative Bewegungsgesetz der Marktwirtschaft
sah?
 Um diese Frage zu beantworten,
mag es nützlich sein, die derzeitige Krise nicht mit ihren eher milden Vorläufern in
der Ära des Neoliberalismus zu vergleichen, sondern mit den Sturmböen der 30er und
der 70er Jahre. Drei Gründe rechtfertigen diese intellektuelle Reise in die
Vergangenheit.
Um diese Frage zu beantworten,
mag es nützlich sein, die derzeitige Krise nicht mit ihren eher milden Vorläufern in
der Ära des Neoliberalismus zu vergleichen, sondern mit den Sturmböen der 30er und
der 70er Jahre. Drei Gründe rechtfertigen diese intellektuelle Reise in die
Vergangenheit.
1.Ökonomisch: Die
derzeitige Krise hat viel schwerwiegender Auswirkungen auf die Finanzinstitutionen als jede
andere Krise seit den 70er Jahren. Obwohl die Wall Street seither einiges an Finanzkrisen
erlebt hat, war sie zugleich immer auch ein sicherer Hafen für internationales Kapital,
das vor einem Finanzdebakel in anderen Teilen der Welt flüchtete.
2. Politisch: Die Fed hat seit
dem Beginn der Krise im Sommer 2007 ihre Zinssätze so aggressiv zurückgefahren wie
1990 und 2001. In diesen beiden Fällen bewirkten diese Senkungen niedrigere Zinsen auf
den Märkten, die die einheimische wie die internationale Kapitalzirkulation ankurbelten.
Derzeit aber bleiben die Zinsen der Banken oben und die Versorgung der Sektoren außerhalb
der Finanzwelt knapp.
3. Ideologisch: Der Staat hat
sich nicht aus der Intervention in die Wirtschaft zurückgezogen, seitdem der
Neoliberalismus den Keynesianismus als vorherrschende Ideologie abgelöst hat. Aber die
neoliberale Ideologie hat diese Intervention mit der Notwendigkeit der Anpassung an die
Globalisierung und die New Economy anzupassen gerechtfertigt. Diese Fassade des neoliberalen
Staates ist jetzt eingestürzt, da er offen Steuergelder in die Kassen der besitzenden
Klassen scheffelt.
Die 30er Jahre: Krise einer werdenden Supermacht
Die Große Depression, die auf den Börsenkrach im Oktober 1929 folgte, kam zu
einem Zeitpunkt, als die USA gerade begonnen hatten, die Weltwirtschaft und die Weltpolitik zu
dominieren. 1918 propagierte der damalige US-Präsident Woodrow Wilson einen
kapitalistischen Internationalismus unter der Führung der USA als Alternative zum
proletarischen Internationalismus, der sich von St.Petersburg und Moskau aus nach Berlin, Wien
und Budapest ausbreitete. Weder die Briten noch die Franzosen hatten, erschöpft durch den
Krieg und konfrontiert mit einer aufsteigenden Welle der Aktivität der Arbeiterklasse,
die Kraft, den Mut und die Fantasie für solch ein weitreichendes Unterfangen.
 Wenige Jahre später
ermöglichten Kapitalimporte aus den USA einen, wenn auch bescheidenen, Wiederaufschwung
der europäischen Ökonomien. Doch waren die USA damals noch nicht in der Lage, die
kapitalistische Welt nach ihrem Bilde zu gestalten. Nicht alle Fraktionen der US-Bourgeoisie
teilten Wilsons Projekt des amerikanischen Internationalismus. Es gab immer noch solche, die
an Weltpolitik, zumindest an europäischer Politik, nicht interessiert waren; andere
dachten, die Frage nach einer US-Hegemonie sei verfrüht.
Wenige Jahre später
ermöglichten Kapitalimporte aus den USA einen, wenn auch bescheidenen, Wiederaufschwung
der europäischen Ökonomien. Doch waren die USA damals noch nicht in der Lage, die
kapitalistische Welt nach ihrem Bilde zu gestalten. Nicht alle Fraktionen der US-Bourgeoisie
teilten Wilsons Projekt des amerikanischen Internationalismus. Es gab immer noch solche, die
an Weltpolitik, zumindest an europäischer Politik, nicht interessiert waren; andere
dachten, die Frage nach einer US-Hegemonie sei verfrüht.
 Auf der anderen Seite des
Atlantiks hing die britische herrschende Klasse, obzwar stark geschwächt durch die
aufstrebende Konkurrenz der USA und Deutschlands und auch durch die Kosten des Krieges, immer
noch ihrem Empire nach und der Vorstellung, sie sei die Herrscherin der Welt. Das war die
Situation, die der italienische Kommunist Antonio Gramsci damals richtig beschrieb als eine,
wo die eine Klasse, die britische Bourgeoisie, nicht länger in der Lage war, ihre
Hegemonie auszuüben, und die andere, die amerikanische Bourgeoisie, noch nicht in der
Lage war, das zu tun.
Auf der anderen Seite des
Atlantiks hing die britische herrschende Klasse, obzwar stark geschwächt durch die
aufstrebende Konkurrenz der USA und Deutschlands und auch durch die Kosten des Krieges, immer
noch ihrem Empire nach und der Vorstellung, sie sei die Herrscherin der Welt. Das war die
Situation, die der italienische Kommunist Antonio Gramsci damals richtig beschrieb als eine,
wo die eine Klasse, die britische Bourgeoisie, nicht länger in der Lage war, ihre
Hegemonie auszuüben, und die andere, die amerikanische Bourgeoisie, noch nicht in der
Lage war, das zu tun.
 Diese
„Hegemonielücke” wurde sichtbar, als britische und amerikanische
Zentralbanker sich im Oktober 1929 nicht darauf verständigen konnten, bei der
Eindämmung des Krachs an der Wall Street zusammenzuarbeiten. In Folge dieser
Nichtzusammenarbeit führte der Kurssturz an der Börse nicht nur zu einem
Preisverfall auf den Rohstoffmärkten, sondern auch zu einem massiven Abzug der Kredite,
der zusammen mit konkurrierenden Abwertungen und einer protektionistischen Zollpolitik den
Weltmarkt zerstörte.
Diese
„Hegemonielücke” wurde sichtbar, als britische und amerikanische
Zentralbanker sich im Oktober 1929 nicht darauf verständigen konnten, bei der
Eindämmung des Krachs an der Wall Street zusammenzuarbeiten. In Folge dieser
Nichtzusammenarbeit führte der Kurssturz an der Börse nicht nur zu einem
Preisverfall auf den Rohstoffmärkten, sondern auch zu einem massiven Abzug der Kredite,
der zusammen mit konkurrierenden Abwertungen und einer protektionistischen Zollpolitik den
Weltmarkt zerstörte.
 Heute ist die Situation ganz
anders. Die Zentralbanken in den Finanzzentren der Welt arbeiten sehr wohl zusammen, aber ihre
Fähigkeit, die internationale Kapitalzirkulation zu stabilisieren, ist begrenzter als je
zuvor seit den 70er Jahren. Das ist kein Anzeichen für eine Hegemonielücke, sondern
für eine Aushöhlung des US-geführten Kapitalismus.
Heute ist die Situation ganz
anders. Die Zentralbanken in den Finanzzentren der Welt arbeiten sehr wohl zusammen, aber ihre
Fähigkeit, die internationale Kapitalzirkulation zu stabilisieren, ist begrenzter als je
zuvor seit den 70er Jahren. Das ist kein Anzeichen für eine Hegemonielücke, sondern
für eine Aushöhlung des US-geführten Kapitalismus.
 Es gibt auch andere Aspekte,
wodurch sich die gegenwärtige Krise von der Situation der 30er Jahre unterscheidet. Die
Finanzkrise von 1929 führte in eine Depression, weil sich die Zirkulation als das
schwächste Glied im Prozess der kapitalistischen Akkumulation erwies und die Politik bei
der Stabilisierung dieses Gliedes scheiterte. Im Verlauf der Depression entwickelten sich dann
verschiedene Faktoren, die schließlich die US-Hegemonie herstellten.
Es gibt auch andere Aspekte,
wodurch sich die gegenwärtige Krise von der Situation der 30er Jahre unterscheidet. Die
Finanzkrise von 1929 führte in eine Depression, weil sich die Zirkulation als das
schwächste Glied im Prozess der kapitalistischen Akkumulation erwies und die Politik bei
der Stabilisierung dieses Gliedes scheiterte. Im Verlauf der Depression entwickelten sich dann
verschiedene Faktoren, die schließlich die US-Hegemonie herstellten.
 Der erste Faktor war eine
Welle von Arbeiterunruhen in den neuen Industriezweigen mit Massenproduktion; sie führte
zu Industriegewerkschaften und zum New Deal. Der zweite Faktor war der Aufstieg
Nazideutschlands, der bewies, dass die deutsche Bourgeoisie nicht aus eigener Kraft in der
Lage war, die Arbeiterbewegung einzudämmen, sondern die Unterstützung einer
radikalisierten Mittelschicht benötigte, die durch die Depression wirtschaftlich ruiniert
worden war. Gleichzeitig zeigten sich die europäischen Mächte, besonders
Großbritannien und Frankreich, unfähig, die Naziaggression und die
„Bedrohung” durch die Kommunistischen Parteien und die Sowjetunion zu stoppen.
Der erste Faktor war eine
Welle von Arbeiterunruhen in den neuen Industriezweigen mit Massenproduktion; sie führte
zu Industriegewerkschaften und zum New Deal. Der zweite Faktor war der Aufstieg
Nazideutschlands, der bewies, dass die deutsche Bourgeoisie nicht aus eigener Kraft in der
Lage war, die Arbeiterbewegung einzudämmen, sondern die Unterstützung einer
radikalisierten Mittelschicht benötigte, die durch die Depression wirtschaftlich ruiniert
worden war. Gleichzeitig zeigten sich die europäischen Mächte, besonders
Großbritannien und Frankreich, unfähig, die Naziaggression und die
„Bedrohung” durch die Kommunistischen Parteien und die Sowjetunion zu stoppen.
 Die international
ausgerichtete Fraktion innerhalb der US-Bourgeoisie nutzte die heimischen und internationalen
Faktoren, um eine Wohlfahrts- und Kriegsökonomie aufzubauen. Gewerkschaften — viele
davon von Kommunisten aufgebaut und geführt — wurden zunächst in den Kampf
gegen den Faschismus einbezogen, der dann aber als antikommunistischer Kreuzzug gegen die
vorgestellte totalitäre Identität zwischen Hitlerdeutschland und der Sowjetunion
fortgesetzt wurde. Ökonomisch war dies möglich, weil die Kriegswirtschaft mit Hilfe
der Techniken der Massenproduktion und einer keynesianischen Nachfragepolitik in eine Geld
produzierende Maschine verwandelt werden konnte.
Die international
ausgerichtete Fraktion innerhalb der US-Bourgeoisie nutzte die heimischen und internationalen
Faktoren, um eine Wohlfahrts- und Kriegsökonomie aufzubauen. Gewerkschaften — viele
davon von Kommunisten aufgebaut und geführt — wurden zunächst in den Kampf
gegen den Faschismus einbezogen, der dann aber als antikommunistischer Kreuzzug gegen die
vorgestellte totalitäre Identität zwischen Hitlerdeutschland und der Sowjetunion
fortgesetzt wurde. Ökonomisch war dies möglich, weil die Kriegswirtschaft mit Hilfe
der Techniken der Massenproduktion und einer keynesianischen Nachfragepolitik in eine Geld
produzierende Maschine verwandelt werden konnte.
 Während die
Weltmachtbestrebungen des britischen Empires und Deutschlands unter den ökonomischen
Kriegskosten litten, waren die USA in der Lage, diese Last in beträchtlichem Maße
auf ihre Alliierten, darunter Großbritannien, abzuwälzen. Darüber hinaus erwies
sich die Massenproduktion in vertikal integrierten Unternehmen als produktiver als die
Produktion in anderen Ländern. Dieser Wettbewerbsvorteil ermöglichte US-Unternehmen,
ohne Profitverluste ihren Arbeitern höhere Löhne zu zahlen; sie wurden zu einem
Modell für die kapitalistische Produktion in anderen Ländern.
Während die
Weltmachtbestrebungen des britischen Empires und Deutschlands unter den ökonomischen
Kriegskosten litten, waren die USA in der Lage, diese Last in beträchtlichem Maße
auf ihre Alliierten, darunter Großbritannien, abzuwälzen. Darüber hinaus erwies
sich die Massenproduktion in vertikal integrierten Unternehmen als produktiver als die
Produktion in anderen Ländern. Dieser Wettbewerbsvorteil ermöglichte US-Unternehmen,
ohne Profitverluste ihren Arbeitern höhere Löhne zu zahlen; sie wurden zu einem
Modell für die kapitalistische Produktion in anderen Ländern.
 Keinen dieser Faktoren gibt es
heute. Die Finanzkrise und die steigende Steuerlast durch Kriege, die nicht gewonnen werden
können, und nun auch durch die Rettung bankrotter Finanzgesellschaften treffen die
Arbeitenden und die Mittelschichten in den USA. Finanzminister Paulsons Versuch, die Last der
Finanzkrise mit den G7-Partnern der USA zu teilen, ist gescheitert. Seine Kollegen
erklärten die Krise rundweg zum amerikanischen Problem und schnürten kleinere
Rettungspakete für ihre eigenen Länder. Generell ist die Kriegswirtschaft kein
Wachstumsmotor mehr, und die US-Konzerne genießen nicht mehr denselben
Effizienzvorsprung, den sie einst hatten, sie hinken nun in vielen Sektoren hinterher.
Keinen dieser Faktoren gibt es
heute. Die Finanzkrise und die steigende Steuerlast durch Kriege, die nicht gewonnen werden
können, und nun auch durch die Rettung bankrotter Finanzgesellschaften treffen die
Arbeitenden und die Mittelschichten in den USA. Finanzminister Paulsons Versuch, die Last der
Finanzkrise mit den G7-Partnern der USA zu teilen, ist gescheitert. Seine Kollegen
erklärten die Krise rundweg zum amerikanischen Problem und schnürten kleinere
Rettungspakete für ihre eigenen Länder. Generell ist die Kriegswirtschaft kein
Wachstumsmotor mehr, und die US-Konzerne genießen nicht mehr denselben
Effizienzvorsprung, den sie einst hatten, sie hinken nun in vielen Sektoren hinterher.
 Um zu begreifen, warum der
Anführer des kapitalistischen Rudels heute so viel weniger glanzvoll und erfolgreich ist
als im Zweiten Weltkrieg und danach, müssen wir die turbulenten 70er Jahre betrachten.
Um zu begreifen, warum der
Anführer des kapitalistischen Rudels heute so viel weniger glanzvoll und erfolgreich ist
als im Zweiten Weltkrieg und danach, müssen wir die turbulenten 70er Jahre betrachten.
Die 70er Jahre: Wiederherstellung von Vertrauen
In den 70er Jahren wurden die Risse im US-Modell des Kapitalismus sichtbar. Zu Hause
protestierten die Bürgerrechts- und die Frauenbewegung gegen die untergeordnete Rolle von
Schwarzen und Frauen im American Way of Life. Werktätige jeder Hautfarbe und beiderlei
Geschlechts rebellierten gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, die Erhöhung
des Arbeitstempos und die Aushöhlung der Kaufkraft ihrer Löhne durch die Inflation.
 Ähnliche Bewegungen
tauchten in allen kapitalistischen Zentren auf, doch die USA waren besonders stark betroffen,
weil dazu noch die Konkurrenz der aufstrebenden Exportmächte Deutschland und Japan kam
und die Eskalation des Vietnamkriegs, der sich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg als
Hemmnis für die Wirtschaft erwies, statt als Wachstumsanreiz. Der Neoliberalismus war die
Antwort auf diese Herausforderung.
Ähnliche Bewegungen
tauchten in allen kapitalistischen Zentren auf, doch die USA waren besonders stark betroffen,
weil dazu noch die Konkurrenz der aufstrebenden Exportmächte Deutschland und Japan kam
und die Eskalation des Vietnamkriegs, der sich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg als
Hemmnis für die Wirtschaft erwies, statt als Wachstumsanreiz. Der Neoliberalismus war die
Antwort auf diese Herausforderung.
 Die schwarze
Bürgerrechtsbewegung wurde — neben der brutalen Unterdrückung ihres radikalen
Flügels, vor allem der Black Panthers — dadurch neutralisiert, dass einem kleinen
Teil von Schwarzen erlaubt wurde, in die Mittelschicht aufzusteigen, und einem noch kleineren
Teil, führende Positionen in der US-Bourgeoisie einzunehmen. Die Mehrzahl der
Afroamerikaner ist jedoch auf der untersten Stufe der US-Gesellschaft geblieben und
konkurriert zunehmend mit — insbesondere hispanischen — Arbeitsimmigranten um gute
Arbeitsplätze in der Industrie und um schlecht bezahlte Jobs.
Die schwarze
Bürgerrechtsbewegung wurde — neben der brutalen Unterdrückung ihres radikalen
Flügels, vor allem der Black Panthers — dadurch neutralisiert, dass einem kleinen
Teil von Schwarzen erlaubt wurde, in die Mittelschicht aufzusteigen, und einem noch kleineren
Teil, führende Positionen in der US-Bourgeoisie einzunehmen. Die Mehrzahl der
Afroamerikaner ist jedoch auf der untersten Stufe der US-Gesellschaft geblieben und
konkurriert zunehmend mit — insbesondere hispanischen — Arbeitsimmigranten um gute
Arbeitsplätze in der Industrie und um schlecht bezahlte Jobs.
 Dieselbe Taktik des
„Teile und herrsche” wurde zur Neutralisierung der Frauenbewegung angewandt:
Manche stiegen in Mittelschichtpositionen auf, während der ökonomische Druck auf den
Rest zunahm, da die Verteidigung des Lebensstandards längere Arbeitszeiten erforderte.
Die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften wurde dadurch untergraben, dass Unternehmen in die
Südstaaten oder in kapitalfreundliche Standorte im Ausland verlagert wurden.
Dieselbe Taktik des
„Teile und herrsche” wurde zur Neutralisierung der Frauenbewegung angewandt:
Manche stiegen in Mittelschichtpositionen auf, während der ökonomische Druck auf den
Rest zunahm, da die Verteidigung des Lebensstandards längere Arbeitszeiten erforderte.
Die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften wurde dadurch untergraben, dass Unternehmen in die
Südstaaten oder in kapitalfreundliche Standorte im Ausland verlagert wurden.
 Die Auswirkungen dieser
Angriffe auf die Arbeiterschaft wurden gemildert durch Möglichkeit für alle,
außer den Angehörigen der alleruntersten sozialen Schichten, an billige Kredite zu
kommen, und durch eine Welle billiger importierter Konsumgüter. Alles in allem trugen
diese beiden Faktoren zum Aufstieg des Pentagon-Wall-Street-Kapitalismus bei.
Die Auswirkungen dieser
Angriffe auf die Arbeiterschaft wurden gemildert durch Möglichkeit für alle,
außer den Angehörigen der alleruntersten sozialen Schichten, an billige Kredite zu
kommen, und durch eine Welle billiger importierter Konsumgüter. Alles in allem trugen
diese beiden Faktoren zum Aufstieg des Pentagon-Wall-Street-Kapitalismus bei.
 Billige Kredite, ergänzt
durch die Akkumulation meist fiktiver finanzieller Vermögenswerte, machten die Wall
Street zum Angelpunkt der Zirkulationsprozesse des Weltkapitalismus. Damit wurden nicht nur
enorme Profite aus Finanzaktivitäten möglich, die Ansprüche auf solche Profite
konnten auch in ein effizientes Druckmittel verwandelt werden, um die Verlagerung und
Reorganisation von Produktionsprozessen durchzusetzen. Das Ergebnis war nicht nur eine
höhere Mehrwertrate — für den Appetit der Wall Street noch nicht hoch genug
—, sondern auch das Auftauchen globaler Wertschöpfungsketten.
Billige Kredite, ergänzt
durch die Akkumulation meist fiktiver finanzieller Vermögenswerte, machten die Wall
Street zum Angelpunkt der Zirkulationsprozesse des Weltkapitalismus. Damit wurden nicht nur
enorme Profite aus Finanzaktivitäten möglich, die Ansprüche auf solche Profite
konnten auch in ein effizientes Druckmittel verwandelt werden, um die Verlagerung und
Reorganisation von Produktionsprozessen durchzusetzen. Das Ergebnis war nicht nur eine
höhere Mehrwertrate — für den Appetit der Wall Street noch nicht hoch genug
—, sondern auch das Auftauchen globaler Wertschöpfungsketten.
 Managerwille allein reichte
dazu nicht. Globale Wertschöpfungsketten erforderten politische Unterstützung zur
Öffnung ausländischer Märkte und zum Schutz des Privateigentums. Teilweise
konnte dies durch diplomatischen Druck erreicht werden — es gab verschiedene
Handelsabkommen, von NAFTA bis zur WTO. Die letzte und verlässlichste Stütze
dafür blieb jedoch der militärisch-industrielle Komplex der USA. Die so
vorangetriebene Akkumulation von Besitz verursachte eine Krise in vielen Ländern der
Welt, aber sie erlaubte den USA auch, an der Heimatfront sozialen Frieden zu bewahren.
Managerwille allein reichte
dazu nicht. Globale Wertschöpfungsketten erforderten politische Unterstützung zur
Öffnung ausländischer Märkte und zum Schutz des Privateigentums. Teilweise
konnte dies durch diplomatischen Druck erreicht werden — es gab verschiedene
Handelsabkommen, von NAFTA bis zur WTO. Die letzte und verlässlichste Stütze
dafür blieb jedoch der militärisch-industrielle Komplex der USA. Die so
vorangetriebene Akkumulation von Besitz verursachte eine Krise in vielen Ländern der
Welt, aber sie erlaubte den USA auch, an der Heimatfront sozialen Frieden zu bewahren.
 Eine Finanzkrise in
Übersee führte regelmäßig zur Kapitalflucht in Richtung Wall Street, die
als sicherer Hafen wahrgenommen wurde, besonders in den Krisen der 80er und 90er Jahre. Damit
konnte die Akkumulation von Buchgeld weitergehen. Die vom IWF als Abhilfe gegen Finanzkrisen
geforderte industrielle Umstrukturierung, steuerliche Konsolidierung und Privatisierung
stellten weitere Vermögenswerte unter das Kommando der Wall Street und noch mehr billige
Konsumgüter auf die Regale der Einkaufszentren.
Eine Finanzkrise in
Übersee führte regelmäßig zur Kapitalflucht in Richtung Wall Street, die
als sicherer Hafen wahrgenommen wurde, besonders in den Krisen der 80er und 90er Jahre. Damit
konnte die Akkumulation von Buchgeld weitergehen. Die vom IWF als Abhilfe gegen Finanzkrisen
geforderte industrielle Umstrukturierung, steuerliche Konsolidierung und Privatisierung
stellten weitere Vermögenswerte unter das Kommando der Wall Street und noch mehr billige
Konsumgüter auf die Regale der Einkaufszentren.
2008: kein Modell mehr
Der Pentagon-Wall-Street-Kapitalismus beruhte auf zwei Glaubenssätzen. Erstens dass
das US-Militär fähig sein würde, das Privateigentum überall auf der Welt
zu schützen. Zweitens dass der Dollar ein verlässlicher Hort für Reichtum sein
würde. In den 70er Jahren konnte die US-Bourgeoisie durch eine entschlossene Wende zum
Neoliberalismus und zu einer aggressiven Außenpolitik die beiden Glaubenssätze
wiederherstellen, die durch die Niederlage der US-Armee in Vietnam, die Abwertung des Dollars
nach der Aufgabe des Systems fester Wechselkurse und die heimische Inflation erschüttert
worden waren.
 Diese Wende versprach einen
effizienteren Schutz von Profiten und Eigentum als die wankelmütige Politik vieler
europäischer Staaten, die noch Kompromisse mit den heimischen Gewerkschaftsführungen
und den Entwicklungsländern suchten.
Diese Wende versprach einen
effizienteren Schutz von Profiten und Eigentum als die wankelmütige Politik vieler
europäischer Staaten, die noch Kompromisse mit den heimischen Gewerkschaftsführungen
und den Entwicklungsländern suchten.
 Dreißig Jahre später
ist dieser Glaube geschwunden. Zwar ist die US-Außenpolitik aggressiver als je zuvor, und
die Bemühungen der Regierung, die Wall Street zu stützen, haben ein beispielloses
Ausmaß erreicht, doch die Resultate sind demütigend. In Afghanistan und im Irak
beweist die größte Militärmacht der Welt, dass sie Regime zerstören kann,
die sie — zumeist einseitig — als inhuman und undemokratisch erklärt. Aber
die USA beweisen auch, dass sie nicht in der Lage sind, eine Gesellschaft des freien Marktes
nach ihrem Bild zu errichten. An der Wall Street kann das Vertrauen der Investoren nicht
einmal durch die Injektion gewaltiger Mengen an Zentralbankgeld und Steuerdollars
wiederhergestellt werden.
Dreißig Jahre später
ist dieser Glaube geschwunden. Zwar ist die US-Außenpolitik aggressiver als je zuvor, und
die Bemühungen der Regierung, die Wall Street zu stützen, haben ein beispielloses
Ausmaß erreicht, doch die Resultate sind demütigend. In Afghanistan und im Irak
beweist die größte Militärmacht der Welt, dass sie Regime zerstören kann,
die sie — zumeist einseitig — als inhuman und undemokratisch erklärt. Aber
die USA beweisen auch, dass sie nicht in der Lage sind, eine Gesellschaft des freien Marktes
nach ihrem Bild zu errichten. An der Wall Street kann das Vertrauen der Investoren nicht
einmal durch die Injektion gewaltiger Mengen an Zentralbankgeld und Steuerdollars
wiederhergestellt werden.
 Darüber hinaus haben
viele Werktätige und Angehörige der Mittelschicht den Verlust des Arbeitsplatzes,
der Altersversorgung oder des Hauses vor Augen. Für sie ist der „amerikanische
Traum” zu Ende. Die USA sind kein Modell mehr für den internationalen Kapitalismus.
Der Grund, weshalb sie immer noch im Führerhaus sitzen, ist, dass es weder alternative
Modelle des Kapitalismus gibt, die eine neue kapitalistische Hegemonie errichten könnten,
noch oppositionelle Bewegungen, die den Anspruch erheben könnten, den Weg in eine
nichtkapitalistische Zukunft zu weisen.
Darüber hinaus haben
viele Werktätige und Angehörige der Mittelschicht den Verlust des Arbeitsplatzes,
der Altersversorgung oder des Hauses vor Augen. Für sie ist der „amerikanische
Traum” zu Ende. Die USA sind kein Modell mehr für den internationalen Kapitalismus.
Der Grund, weshalb sie immer noch im Führerhaus sitzen, ist, dass es weder alternative
Modelle des Kapitalismus gibt, die eine neue kapitalistische Hegemonie errichten könnten,
noch oppositionelle Bewegungen, die den Anspruch erheben könnten, den Weg in eine
nichtkapitalistische Zukunft zu weisen.
 Als der deutsche
Finanzminister Steinbrück am 25.September vor dem Bundestag erklärte, die USA
wären dabei, ihren „Status als finanzielle Supermacht” zu verlieren, rauschte
es mächtig im Blätterwald. In anderen Ländern drückten Regierungen sich
ähnlich aus. Solche Kommentare bedeuten jedoch nicht viel. Nirgendwo sonst wird eine
Alternative zum schrumpfenden Pentagon-Wall-Street-Kapitalismus auch nur ansatzweise sichtbar.
Als der deutsche
Finanzminister Steinbrück am 25.September vor dem Bundestag erklärte, die USA
wären dabei, ihren „Status als finanzielle Supermacht” zu verlieren, rauschte
es mächtig im Blätterwald. In anderen Ländern drückten Regierungen sich
ähnlich aus. Solche Kommentare bedeuten jedoch nicht viel. Nirgendwo sonst wird eine
Alternative zum schrumpfenden Pentagon-Wall-Street-Kapitalismus auch nur ansatzweise sichtbar.
 Als Komplizen des US-Empires,
die sie waren und noch immer sind, sind die Regierungen anderer Länder damit
beschäftigt, die Auswirkungen der in den USA ausgelösten Krise einzudämmen. Die
Briten haben immer noch mit den Folgen des Northern-Rock-Debakels im vergangenen Jahr zu
kämpfen; die Deutschen mit den Verlusten der IKB; und alle zusammen bereiten sich die
herrschenden Klassen der ganzen Welt auf eine Rezession vor. Anders als während der
Krisen der letzten 20 Jahre prahlen sie diesmal nicht mit einer raschen Erholung. Stattdessen
malen sie ein ziemlich düsteres Bild der Zukunft und bereiten die unteren Klassen auf
einen umfassenden Anschlag auf ihre Arbeits- und Lebensbedingungen vor.
Als Komplizen des US-Empires,
die sie waren und noch immer sind, sind die Regierungen anderer Länder damit
beschäftigt, die Auswirkungen der in den USA ausgelösten Krise einzudämmen. Die
Briten haben immer noch mit den Folgen des Northern-Rock-Debakels im vergangenen Jahr zu
kämpfen; die Deutschen mit den Verlusten der IKB; und alle zusammen bereiten sich die
herrschenden Klassen der ganzen Welt auf eine Rezession vor. Anders als während der
Krisen der letzten 20 Jahre prahlen sie diesmal nicht mit einer raschen Erholung. Stattdessen
malen sie ein ziemlich düsteres Bild der Zukunft und bereiten die unteren Klassen auf
einen umfassenden Anschlag auf ihre Arbeits- und Lebensbedingungen vor.
 Bislang hat es keine
größere Reaktion seitens der Gewerkschaften und anderer sozialer Bewegungen gegeben.
Gewöhnt an die Vorstellung von allmächtigen Finanzmärkten ist es schwierig,
sich auf eine Situation einzustellen, wo die Zuversicht jener, die bis vor kurzem als die
Herren des Universums auftraten, zutiefst erschüttert ist. Der New York City Labor
Council hat in der Wall Street eine Protestkundgebung gegen Paulsons großzügigen
Rettungsplan auf Kosten der weniger Reichen und der Armen organisiert. Dies war vielleicht nur
eine symbolische Aktion, aber sie weist in eine interessante Richtung: Die einfachen Leute
fordern die Wall Street und andere Finanzzentren der Welt heraus...
Bislang hat es keine
größere Reaktion seitens der Gewerkschaften und anderer sozialer Bewegungen gegeben.
Gewöhnt an die Vorstellung von allmächtigen Finanzmärkten ist es schwierig,
sich auf eine Situation einzustellen, wo die Zuversicht jener, die bis vor kurzem als die
Herren des Universums auftraten, zutiefst erschüttert ist. Der New York City Labor
Council hat in der Wall Street eine Protestkundgebung gegen Paulsons großzügigen
Rettungsplan auf Kosten der weniger Reichen und der Armen organisiert. Dies war vielleicht nur
eine symbolische Aktion, aber sie weist in eine interessante Richtung: Die einfachen Leute
fordern die Wall Street und andere Finanzzentren der Welt heraus...
Ich möchte die SoZ mal in der Hand halten
und bestelle eine kostenlose Probeausgabe oder ein Probeabo
|
|

|
|
Sozialistische Hefte
für Theorie und Praxis
Sonderausgabe der SoZ
42 Seiten, 5 Euro,
|
|
|
Der Stand der Dinge
Perry Anderson überblickt den westpolitischen Stand der Dinge
Gregory Albo untersucht den anhaltenden politischen Erfolg des Neoliberalismus und die Schwäche der Linken
Alfredo Saa-Fidho verdeutlicht die Unterschiede der keynsianischen und der marxistischen Kritik des Neoliberalismus
Ulrich Duchrow fragt nach den psychischen Mechanismen und Kosten des Neoliberlismus
Walter Benn Michaelis sieht in Barack Obama das neue Pin-Up des Neoliberalismus und zeigt, dass es nicht reicht, nur von Vielfalt zu reden
Christoph Jünke über Karl Liebknechts Aktualität
|
|

 Boom oder Pleite, die Wall
Street kann einen beschäftigen. Jedermann diskutiert dieser Tage über das 700
Milliarden Dollar schwere Rettungspaket der US-Regierung. Nach der Pleite der Investmentbank
Lehman Brothers ist die große Frage: Wer kommt als nächstes?
Boom oder Pleite, die Wall
Street kann einen beschäftigen. Jedermann diskutiert dieser Tage über das 700
Milliarden Dollar schwere Rettungspaket der US-Regierung. Nach der Pleite der Investmentbank
Lehman Brothers ist die große Frage: Wer kommt als nächstes?
 Letzten Monat wurde
darüber spekuliert, ob der Verfall der Ölpreise und ein steigender US-Dollar wieder
einen neuen Boom anzeigen. Letztes Jahr waren wir schon einmal soweit: Ängste, die
Turbulenzen an den Finanzmärkten könnten die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft in
die Rezession treiben. Im Verlauf des Jahres erreichte der Ölpreis Rekordhöhen (1,44
US-Dollar im Juli), der US-Dollar Rekordtiefen (1,60 Dollar für 1 Euro im April) und das
Flaggschiff des US-Finanzkapitals, die Investmentbanken, versank.
Letzten Monat wurde
darüber spekuliert, ob der Verfall der Ölpreise und ein steigender US-Dollar wieder
einen neuen Boom anzeigen. Letztes Jahr waren wir schon einmal soweit: Ängste, die
Turbulenzen an den Finanzmärkten könnten die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft in
die Rezession treiben. Im Verlauf des Jahres erreichte der Ölpreis Rekordhöhen (1,44
US-Dollar im Juli), der US-Dollar Rekordtiefen (1,60 Dollar für 1 Euro im April) und das
Flaggschiff des US-Finanzkapitals, die Investmentbanken, versank.
 Bear Stearns und Merrill Lynch
wurden jeweils von JP Morgan Chase und der Bank of America übernommen. Die beiden
Letzteren sind Geschäftsbanken, keine Investmentbanken. Das bedeutet, dass sie der
Bankenaufsicht unterstehen und sich bei der Zentralbank refinanzieren können, statt ihre
Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt auszugeben und zu verkaufen, wie Investmentbanken. Auch
Goldman Sachs und Morgan Stanley sind unter den Schutz der US-Notenbank gekrochen, nachdem
Lehman Brothers schutzlos auf dem Kapitalmarkt untergegangen ist.
Bear Stearns und Merrill Lynch
wurden jeweils von JP Morgan Chase und der Bank of America übernommen. Die beiden
Letzteren sind Geschäftsbanken, keine Investmentbanken. Das bedeutet, dass sie der
Bankenaufsicht unterstehen und sich bei der Zentralbank refinanzieren können, statt ihre
Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt auszugeben und zu verkaufen, wie Investmentbanken. Auch
Goldman Sachs und Morgan Stanley sind unter den Schutz der US-Notenbank gekrochen, nachdem
Lehman Brothers schutzlos auf dem Kapitalmarkt untergegangen ist.
 Der Untergang der
Investmentbanken in den USA und im weiteren Sinne die globale Instabilität der
Finanzmärkte haben in Washington, Frankfurt, Tokyo und London zu Interventionen der
Regierungen und der Zentralbanken geführt. Umfangreiche Rettungspakete und staatliche
Übernahmen von Finanz- und Hypothekeninstituten — wovon Fannie Mae, Freddie Mac und
AIG nur die prominentesten, aber längst nicht die einzigen sind — provozierten
zusammen mit Konjunkturpaketen verärgerte Kommentare bei Marktkonservativen, die die USA
schon auf dem Marsch in den Sozialismus witterten. Diese Leute müssen es wirklich schwer
haben.
Der Untergang der
Investmentbanken in den USA und im weiteren Sinne die globale Instabilität der
Finanzmärkte haben in Washington, Frankfurt, Tokyo und London zu Interventionen der
Regierungen und der Zentralbanken geführt. Umfangreiche Rettungspakete und staatliche
Übernahmen von Finanz- und Hypothekeninstituten — wovon Fannie Mae, Freddie Mac und
AIG nur die prominentesten, aber längst nicht die einzigen sind — provozierten
zusammen mit Konjunkturpaketen verärgerte Kommentare bei Marktkonservativen, die die USA
schon auf dem Marsch in den Sozialismus witterten. Diese Leute müssen es wirklich schwer
haben.
