| SoZ - Sozialistische Zeitung |
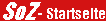 SoZ - Sozialistische Zeitung, April 2009, Seite 13
SoZ - Sozialistische Zeitung, April 2009, Seite 13
Solidarische Ökonomie:
Fundierte Kapitalismuskritik — klare Gegenentwürfe
von Benedict Ugarte Chacón
Wolfgang Fabricius, Solidarische Ökonomie auf der Basis von
Reproduktionsgenossenschaften, Berlin: BoD, 2008, 15 Euro.
Wolfgang Fabricius zählt zum Urgestein dessen, was man in
Berlin „Alternative Szene” nennt. Immer schon alternativ-politisch unterwegs, war
er in den 70er Jahren Mitbegründer des Mehringhofs und des Gesundheitsladens, in
jüngerer Zeit wirkte er als Gründungsmitglied von Attac Berlin und des Berliner
Sozialforums.
 Seine Erkenntnisse und
Erfahrungen zu Ökonomie und Politik, die er auf seinem jahrzehntelangen Weg abseits
etablierter Institutionen in zahlreichen Initiativen sammelte, hat er nun in ein Buch gepackt
und es mit dem Titel Solidarische Ökonomie auf der Basis von
Reproduktionsgenossenschaften versehen. Dieser Titel ist das einzig Sperrige am vorgelegten
Werk, das sich ansonsten gut liest und sich damit deutlich von anderen kritischen
politökonomischen Bleiwüsten unterscheidet.
Seine Erkenntnisse und
Erfahrungen zu Ökonomie und Politik, die er auf seinem jahrzehntelangen Weg abseits
etablierter Institutionen in zahlreichen Initiativen sammelte, hat er nun in ein Buch gepackt
und es mit dem Titel Solidarische Ökonomie auf der Basis von
Reproduktionsgenossenschaften versehen. Dieser Titel ist das einzig Sperrige am vorgelegten
Werk, das sich ansonsten gut liest und sich damit deutlich von anderen kritischen
politökonomischen Bleiwüsten unterscheidet.
 Fabricius sieht in der
Solidarischen Ökonomie, die sich in Genossenschaften institutionalisieren kann, eine
Alternative zu einer Wirtschaftsform, deren einziges Ziel die Profitmaximierung ist. Bei der
Solidarischen Ökonomie würde der „menschliche Bedarf ... die Rendite als
Triebfeder der Wirtschaft” ablösen. Kurzum: Der Autor betreibt handfeste
Kapitalismuskritik, die klare Gegenentwürfe präsentiert und deshalb intelligenter
daherkommt, als so manche echte oder scheinbare kapitalismuskritische Platitüde.
Fabricius sieht in der
Solidarischen Ökonomie, die sich in Genossenschaften institutionalisieren kann, eine
Alternative zu einer Wirtschaftsform, deren einziges Ziel die Profitmaximierung ist. Bei der
Solidarischen Ökonomie würde der „menschliche Bedarf ... die Rendite als
Triebfeder der Wirtschaft” ablösen. Kurzum: Der Autor betreibt handfeste
Kapitalismuskritik, die klare Gegenentwürfe präsentiert und deshalb intelligenter
daherkommt, als so manche echte oder scheinbare kapitalismuskritische Platitüde.
 Sein Buch bietet einen kurzen
und prägnanten Überblick über ökonomische Grundbegriffe, der schon allein
wegen seiner präzisen Knappheit lesenswert ist. Sachkundig setzt er sich mit der
„neoliberalen Globalideologie” auseinander und analysiert den aktuellen
Kapitalismus als krisenanfälliges System, dessen wiederholte „Rettung”
zumeist aus Maßnahmen bestand, die die „Besitzenden” weiter besitzen und die
„Besitzlosen” dafür aufkommen ließen.
Sein Buch bietet einen kurzen
und prägnanten Überblick über ökonomische Grundbegriffe, der schon allein
wegen seiner präzisen Knappheit lesenswert ist. Sachkundig setzt er sich mit der
„neoliberalen Globalideologie” auseinander und analysiert den aktuellen
Kapitalismus als krisenanfälliges System, dessen wiederholte „Rettung”
zumeist aus Maßnahmen bestand, die die „Besitzenden” weiter besitzen und die
„Besitzlosen” dafür aufkommen ließen.
 Doch bei der Analyse allein
kann es nicht bleiben. Schon auf den ersten Seiten des Buches weit Fabricius auf ein
grundlegendes Manko hin: „Die politischen Aktivitäten der globalen sozialen
Bewegungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Kritik des bestehenden Systems und
daraus abgeleiteten Forderungen. Sie befassen sich nicht, oder nur sehr unzureichend, mit der
Konzeption und Erprobung einer ökonomischen Grundlage für die propagierte
‘andere Welt‘ und setzen ihre Hoffnungen in Parteien oder den Staat."
Doch bei der Analyse allein
kann es nicht bleiben. Schon auf den ersten Seiten des Buches weit Fabricius auf ein
grundlegendes Manko hin: „Die politischen Aktivitäten der globalen sozialen
Bewegungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Kritik des bestehenden Systems und
daraus abgeleiteten Forderungen. Sie befassen sich nicht, oder nur sehr unzureichend, mit der
Konzeption und Erprobung einer ökonomischen Grundlage für die propagierte
‘andere Welt‘ und setzen ihre Hoffnungen in Parteien oder den Staat."
 Um dem zu entgehen, bietet
Fabricius — einige theoretische Überlegungen voranstellend — im zweiten Teil
seines Buches einen Fundus an Beispielen, wie eine Solidarische Ökonomie umgesetzt werden
kann. Vom historischen Überblick über die Entwicklung des Genossenschaftswesens bis
hin zu nationalen und internationalen Beispielen der heutigen Zeit wird alles geboten, selbst
marktradikale Gegner des Genossenschaftswesens könnten sich hier umfassend informieren.
Um dem zu entgehen, bietet
Fabricius — einige theoretische Überlegungen voranstellend — im zweiten Teil
seines Buches einen Fundus an Beispielen, wie eine Solidarische Ökonomie umgesetzt werden
kann. Vom historischen Überblick über die Entwicklung des Genossenschaftswesens bis
hin zu nationalen und internationalen Beispielen der heutigen Zeit wird alles geboten, selbst
marktradikale Gegner des Genossenschaftswesens könnten sich hier umfassend informieren.
 Und wenn Fabricius die
Maßstäbe an ein wirkliches Genossenschaftswesen auch recht hoch ansiedelt — so
hat bspw. eine Genossenschaft eigentlich die Rollen des Bürgers als Konsument und als
Produzent zu vereinigen und eine entsprechende basisdemokratische Organisation aufzuweisen
— bleibt seine Kritik am real existierenden Genossenschaftswesen erstaunlich zaghaft.
Schimmert hier etwa schon eine gewisse Altersmilde durch? Oder spart sich der Autor die
Abrechnung für ein weiteres Buch auf?
Und wenn Fabricius die
Maßstäbe an ein wirkliches Genossenschaftswesen auch recht hoch ansiedelt — so
hat bspw. eine Genossenschaft eigentlich die Rollen des Bürgers als Konsument und als
Produzent zu vereinigen und eine entsprechende basisdemokratische Organisation aufzuweisen
— bleibt seine Kritik am real existierenden Genossenschaftswesen erstaunlich zaghaft.
Schimmert hier etwa schon eine gewisse Altersmilde durch? Oder spart sich der Autor die
Abrechnung für ein weiteres Buch auf?
 Fest steht: Wer über
Alternativen zum jetzigen Wirtschaftssystem diskutieren will, findet bei Fabricius ein gute
Grundlage — und wer ihn widerlegen will, hat einige Arbeit vor sich.
Fest steht: Wer über
Alternativen zum jetzigen Wirtschaftssystem diskutieren will, findet bei Fabricius ein gute
Grundlage — und wer ihn widerlegen will, hat einige Arbeit vor sich.
Ich möchte die SoZ mal in der Hand halten
und bestelle eine kostenlose Probeausgabe oder ein Probeabo
|
|

|
|
Sozialistische Hefte
für Theorie und Praxis
Sonderausgabe der SoZ
42 Seiten, 5 Euro,
|
|
|
Der Stand der Dinge
Perry Anderson überblickt den westpolitischen Stand der Dinge
Gregory Albo untersucht den anhaltenden politischen Erfolg des Neoliberalismus und die Schwäche der Linken
Alfredo Saa-Fidho verdeutlicht die Unterschiede der keynsianischen und der marxistischen Kritik des Neoliberalismus
Ulrich Duchrow fragt nach den psychischen Mechanismen und Kosten des Neoliberlismus
Walter Benn Michaelis sieht in Barack Obama das neue Pin-Up des Neoliberalismus und zeigt, dass es nicht reicht, nur von Vielfalt zu reden
Christoph Jünke über Karl Liebknechts Aktualität
|
|

 Seine Erkenntnisse und
Erfahrungen zu Ökonomie und Politik, die er auf seinem jahrzehntelangen Weg abseits
etablierter Institutionen in zahlreichen Initiativen sammelte, hat er nun in ein Buch gepackt
und es mit dem Titel Solidarische Ökonomie auf der Basis von
Reproduktionsgenossenschaften versehen. Dieser Titel ist das einzig Sperrige am vorgelegten
Werk, das sich ansonsten gut liest und sich damit deutlich von anderen kritischen
politökonomischen Bleiwüsten unterscheidet.
Seine Erkenntnisse und
Erfahrungen zu Ökonomie und Politik, die er auf seinem jahrzehntelangen Weg abseits
etablierter Institutionen in zahlreichen Initiativen sammelte, hat er nun in ein Buch gepackt
und es mit dem Titel Solidarische Ökonomie auf der Basis von
Reproduktionsgenossenschaften versehen. Dieser Titel ist das einzig Sperrige am vorgelegten
Werk, das sich ansonsten gut liest und sich damit deutlich von anderen kritischen
politökonomischen Bleiwüsten unterscheidet.
 Fabricius sieht in der
Solidarischen Ökonomie, die sich in Genossenschaften institutionalisieren kann, eine
Alternative zu einer Wirtschaftsform, deren einziges Ziel die Profitmaximierung ist. Bei der
Solidarischen Ökonomie würde der „menschliche Bedarf ... die Rendite als
Triebfeder der Wirtschaft” ablösen. Kurzum: Der Autor betreibt handfeste
Kapitalismuskritik, die klare Gegenentwürfe präsentiert und deshalb intelligenter
daherkommt, als so manche echte oder scheinbare kapitalismuskritische Platitüde.
Fabricius sieht in der
Solidarischen Ökonomie, die sich in Genossenschaften institutionalisieren kann, eine
Alternative zu einer Wirtschaftsform, deren einziges Ziel die Profitmaximierung ist. Bei der
Solidarischen Ökonomie würde der „menschliche Bedarf ... die Rendite als
Triebfeder der Wirtschaft” ablösen. Kurzum: Der Autor betreibt handfeste
Kapitalismuskritik, die klare Gegenentwürfe präsentiert und deshalb intelligenter
daherkommt, als so manche echte oder scheinbare kapitalismuskritische Platitüde.
 Sein Buch bietet einen kurzen
und prägnanten Überblick über ökonomische Grundbegriffe, der schon allein
wegen seiner präzisen Knappheit lesenswert ist. Sachkundig setzt er sich mit der
„neoliberalen Globalideologie” auseinander und analysiert den aktuellen
Kapitalismus als krisenanfälliges System, dessen wiederholte „Rettung”
zumeist aus Maßnahmen bestand, die die „Besitzenden” weiter besitzen und die
„Besitzlosen” dafür aufkommen ließen.
Sein Buch bietet einen kurzen
und prägnanten Überblick über ökonomische Grundbegriffe, der schon allein
wegen seiner präzisen Knappheit lesenswert ist. Sachkundig setzt er sich mit der
„neoliberalen Globalideologie” auseinander und analysiert den aktuellen
Kapitalismus als krisenanfälliges System, dessen wiederholte „Rettung”
zumeist aus Maßnahmen bestand, die die „Besitzenden” weiter besitzen und die
„Besitzlosen” dafür aufkommen ließen.
 Doch bei der Analyse allein
kann es nicht bleiben. Schon auf den ersten Seiten des Buches weit Fabricius auf ein
grundlegendes Manko hin: „Die politischen Aktivitäten der globalen sozialen
Bewegungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Kritik des bestehenden Systems und
daraus abgeleiteten Forderungen. Sie befassen sich nicht, oder nur sehr unzureichend, mit der
Konzeption und Erprobung einer ökonomischen Grundlage für die propagierte
‘andere Welt‘ und setzen ihre Hoffnungen in Parteien oder den Staat."
Doch bei der Analyse allein
kann es nicht bleiben. Schon auf den ersten Seiten des Buches weit Fabricius auf ein
grundlegendes Manko hin: „Die politischen Aktivitäten der globalen sozialen
Bewegungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Kritik des bestehenden Systems und
daraus abgeleiteten Forderungen. Sie befassen sich nicht, oder nur sehr unzureichend, mit der
Konzeption und Erprobung einer ökonomischen Grundlage für die propagierte
‘andere Welt‘ und setzen ihre Hoffnungen in Parteien oder den Staat."
 Um dem zu entgehen, bietet
Fabricius — einige theoretische Überlegungen voranstellend — im zweiten Teil
seines Buches einen Fundus an Beispielen, wie eine Solidarische Ökonomie umgesetzt werden
kann. Vom historischen Überblick über die Entwicklung des Genossenschaftswesens bis
hin zu nationalen und internationalen Beispielen der heutigen Zeit wird alles geboten, selbst
marktradikale Gegner des Genossenschaftswesens könnten sich hier umfassend informieren.
Um dem zu entgehen, bietet
Fabricius — einige theoretische Überlegungen voranstellend — im zweiten Teil
seines Buches einen Fundus an Beispielen, wie eine Solidarische Ökonomie umgesetzt werden
kann. Vom historischen Überblick über die Entwicklung des Genossenschaftswesens bis
hin zu nationalen und internationalen Beispielen der heutigen Zeit wird alles geboten, selbst
marktradikale Gegner des Genossenschaftswesens könnten sich hier umfassend informieren.
 Und wenn Fabricius die
Maßstäbe an ein wirkliches Genossenschaftswesen auch recht hoch ansiedelt — so
hat bspw. eine Genossenschaft eigentlich die Rollen des Bürgers als Konsument und als
Produzent zu vereinigen und eine entsprechende basisdemokratische Organisation aufzuweisen
— bleibt seine Kritik am real existierenden Genossenschaftswesen erstaunlich zaghaft.
Schimmert hier etwa schon eine gewisse Altersmilde durch? Oder spart sich der Autor die
Abrechnung für ein weiteres Buch auf?
Und wenn Fabricius die
Maßstäbe an ein wirkliches Genossenschaftswesen auch recht hoch ansiedelt — so
hat bspw. eine Genossenschaft eigentlich die Rollen des Bürgers als Konsument und als
Produzent zu vereinigen und eine entsprechende basisdemokratische Organisation aufzuweisen
— bleibt seine Kritik am real existierenden Genossenschaftswesen erstaunlich zaghaft.
Schimmert hier etwa schon eine gewisse Altersmilde durch? Oder spart sich der Autor die
Abrechnung für ein weiteres Buch auf?
 Fest steht: Wer über
Alternativen zum jetzigen Wirtschaftssystem diskutieren will, findet bei Fabricius ein gute
Grundlage — und wer ihn widerlegen will, hat einige Arbeit vor sich.
Fest steht: Wer über
Alternativen zum jetzigen Wirtschaftssystem diskutieren will, findet bei Fabricius ein gute
Grundlage — und wer ihn widerlegen will, hat einige Arbeit vor sich.
