| SoZ - Sozialistische Zeitung |
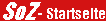 SoZ - Sozialistische Zeitung, Oktober 2009, Seite 10
SoZ - Sozialistische Zeitung, Oktober 2009, Seite 10
Hilft die „Mitarbeiterbeteiligung” in der Krise?
Ein Vorschlag der IG Metall zur Erneuerung der Sozialpartnerschaft
von Jochen Gester
Der IGM-Vorsitzende, Berthold Huber, hat vorgeschlagen,
Beschäftigte eines Unternehmens am Kapital zu beteiligen. Er hat damit eine heftige
Debatte ausgelöst, bei der Pro und Contra sowohl von Gewerkschaften wie Unternehmern
kommen.
 Sehr wenig spricht dafür,
dass die aktuelle Wirtschaftskrise ihren Zenit bereits überschritten hat und eine
Trendwende zu erneutem Wirtschaftswachstum bevorsteht. Noch weniger dafür, dass sich die
Situation auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten entspannt. Wir stehen vor
Massenentlassungen und schweren Angriffen auf den Lebensstandard und die materielle Existenz
der Lohnabhängigen. Nicht nur die Partei des Herrn Westerwelle demonstriert mit ihren
aberwitzigen Steuersenkungsforderungen und Vorschlägen zur Verschärfung von Hartz
IV, wen die Vermögensbesitzer dazu auserkoren haben, die jährlichen 100 Milliarden,
die im Staatshaushalt fehlen werden, durch mehr und schlechter bezahlte Arbeit und durch
Verzicht aufzubringen; auch der Finanzminister sagt „harte Verteilungskämpfe”
voraus. Angesichts dieser Aussichten fragt man sich, wie dies mit der Debatte um die
Mitarbeiterbeteiligung zu vereinbaren ist, die vor allem auf den Wirtschaftsseiten der
besseren Zeitungen geführt wird.
Sehr wenig spricht dafür,
dass die aktuelle Wirtschaftskrise ihren Zenit bereits überschritten hat und eine
Trendwende zu erneutem Wirtschaftswachstum bevorsteht. Noch weniger dafür, dass sich die
Situation auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten entspannt. Wir stehen vor
Massenentlassungen und schweren Angriffen auf den Lebensstandard und die materielle Existenz
der Lohnabhängigen. Nicht nur die Partei des Herrn Westerwelle demonstriert mit ihren
aberwitzigen Steuersenkungsforderungen und Vorschlägen zur Verschärfung von Hartz
IV, wen die Vermögensbesitzer dazu auserkoren haben, die jährlichen 100 Milliarden,
die im Staatshaushalt fehlen werden, durch mehr und schlechter bezahlte Arbeit und durch
Verzicht aufzubringen; auch der Finanzminister sagt „harte Verteilungskämpfe”
voraus. Angesichts dieser Aussichten fragt man sich, wie dies mit der Debatte um die
Mitarbeiterbeteiligung zu vereinbaren ist, die vor allem auf den Wirtschaftsseiten der
besseren Zeitungen geführt wird.
 Das Thema selbst ist nicht
neu. Seit den 50er Jahren kommt es wellenförmig immer wieder auf, mit wechselnden
Etiketten. Ein frühes Beispiel für die Propagierung dieser Art
„Volkskapitalismus” war der „Investivlohn”, den auch der
antikommunistische Vorsitzende der IG Bergbau und Energie, Georg Leber, befürwortete und
dabei auf heftigen Widerspruch des damaligen IGM-Vorsitzenden Otto Brenner stieß, der die
Mitbestimmung noch zum Hebel für die Überwindung des Kapitalismus ausbauen wollte.
Später wurde das sog. „624-Mark-Gesetz” als „Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand” eingeführt. Doch auch diese Reform konnte die grundsätzliche
Abhängigkeit der Lohnarbeiter nicht mindern. Das zusätzliche
„Zwangssparen” wurde gerne mitgenommen und diente in der Regel größeren
Anschaffungen.
Das Thema selbst ist nicht
neu. Seit den 50er Jahren kommt es wellenförmig immer wieder auf, mit wechselnden
Etiketten. Ein frühes Beispiel für die Propagierung dieser Art
„Volkskapitalismus” war der „Investivlohn”, den auch der
antikommunistische Vorsitzende der IG Bergbau und Energie, Georg Leber, befürwortete und
dabei auf heftigen Widerspruch des damaligen IGM-Vorsitzenden Otto Brenner stieß, der die
Mitbestimmung noch zum Hebel für die Überwindung des Kapitalismus ausbauen wollte.
Später wurde das sog. „624-Mark-Gesetz” als „Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand” eingeführt. Doch auch diese Reform konnte die grundsätzliche
Abhängigkeit der Lohnarbeiter nicht mindern. Das zusätzliche
„Zwangssparen” wurde gerne mitgenommen und diente in der Regel größeren
Anschaffungen.
 Unabhängig von dieser
gesetzlichen Regelung, auf die alle Beschäftigten einen Anspruch hatten, gab und gibt es
diverse Formen von Mitarbeiterbeteiligung auf betrieblicher Ebene, die jedoch in weniger als
10% der Betriebe gewährt wird. Verhaltensrelevante Summen werden nur in einigen der
großen DAX-Firmen gezahlt. Die Beschäftigten können eine bestimmte Anzahl von
Aktien zum Vorzugspreis kaufen, erhalten darauf Dividenden und profitieren gegebenenfalls von
der Kurssteigerung. Um das Interesse am Erfolg des Unternehmens, das sie beschäftigt,
für Beschäftigte kleinerer Betriebe zu fördern und die Liquidität des
Unternehmens zu verbessern, hat die derzeitige Große Koalition nun ein Gesetz gemacht,
das den Betrag, den der Mitarbeiter steuerfrei in der Firma investieren kann, von 72 auf 400
Euro erhöht und dafür die Einkommensgrenzen heraufgesetzt. Klar ist: Hier wird kein
großes Rad gedreht.
Unabhängig von dieser
gesetzlichen Regelung, auf die alle Beschäftigten einen Anspruch hatten, gab und gibt es
diverse Formen von Mitarbeiterbeteiligung auf betrieblicher Ebene, die jedoch in weniger als
10% der Betriebe gewährt wird. Verhaltensrelevante Summen werden nur in einigen der
großen DAX-Firmen gezahlt. Die Beschäftigten können eine bestimmte Anzahl von
Aktien zum Vorzugspreis kaufen, erhalten darauf Dividenden und profitieren gegebenenfalls von
der Kurssteigerung. Um das Interesse am Erfolg des Unternehmens, das sie beschäftigt,
für Beschäftigte kleinerer Betriebe zu fördern und die Liquidität des
Unternehmens zu verbessern, hat die derzeitige Große Koalition nun ein Gesetz gemacht,
das den Betrag, den der Mitarbeiter steuerfrei in der Firma investieren kann, von 72 auf 400
Euro erhöht und dafür die Einkommensgrenzen heraufgesetzt. Klar ist: Hier wird kein
großes Rad gedreht.
 Bringt die gegenwärtige
Debatte dazu etwas Neues? Neu scheinen die Positionen zu sein, die vom IG-Metall-Vorstand in
die Diskussion gebracht und teilweise bereits realisiert werden. Die IG Metall
befürwortet Mitarbeiterbeteiligung nicht als individuellen Einstieg des Arbeitnehmers in
die betriebliche Vermögensbildung, sondern als kollektive Beteiligung der Belegschaft am
Betriebseigentum. Im Rahmen der Adam Opel AG wurde eine Mitarbeiterbeteiligungs-AG
gegründet, in die Lohnbestandteile und Forderungen der Belegschaft im Wert von 1,5 Mrd.
Euro eingebracht werden. Der Euro-BR-Vorsitzende Klaus Franz kann sich eine 10%ige Beteiligung
am Firmenkapital vorstellen. Auch bei Daimler arbeiten Geschäftsleitung und Betriebsrat
an einem Modell, das erlaubt, Lohnbestandteile einzubehalten. So wird über die
Nichtauszahlung der Erfolgsprämie 2008 ein Betrag von 1900 Euro je Mitarbeiter zu einer
Kapitalbeteiligung. Bei Schaeffler haben BR und IGM einen Deal eingefädelt, der
Lohnsteigerungen von 250 Mio. Euro pro Jahr in Unternehmensbeteiligungen verwandelt, was einem
Anteil von etwa 4% am Firmenkapital entspricht. Auch bei VW ist eine Mitarbeiterbeteiligung in
dieser Form vorgesehen, die die Belegschaft zum Shareholder bis zu 5% machen kann. Bertold
Huber hatte sogar gehofft, für die Zustimmung zum neuen Vertrag zwischen VW und Porsche
eine 10%ige Beteiligung zu bekommen.
Bringt die gegenwärtige
Debatte dazu etwas Neues? Neu scheinen die Positionen zu sein, die vom IG-Metall-Vorstand in
die Diskussion gebracht und teilweise bereits realisiert werden. Die IG Metall
befürwortet Mitarbeiterbeteiligung nicht als individuellen Einstieg des Arbeitnehmers in
die betriebliche Vermögensbildung, sondern als kollektive Beteiligung der Belegschaft am
Betriebseigentum. Im Rahmen der Adam Opel AG wurde eine Mitarbeiterbeteiligungs-AG
gegründet, in die Lohnbestandteile und Forderungen der Belegschaft im Wert von 1,5 Mrd.
Euro eingebracht werden. Der Euro-BR-Vorsitzende Klaus Franz kann sich eine 10%ige Beteiligung
am Firmenkapital vorstellen. Auch bei Daimler arbeiten Geschäftsleitung und Betriebsrat
an einem Modell, das erlaubt, Lohnbestandteile einzubehalten. So wird über die
Nichtauszahlung der Erfolgsprämie 2008 ein Betrag von 1900 Euro je Mitarbeiter zu einer
Kapitalbeteiligung. Bei Schaeffler haben BR und IGM einen Deal eingefädelt, der
Lohnsteigerungen von 250 Mio. Euro pro Jahr in Unternehmensbeteiligungen verwandelt, was einem
Anteil von etwa 4% am Firmenkapital entspricht. Auch bei VW ist eine Mitarbeiterbeteiligung in
dieser Form vorgesehen, die die Belegschaft zum Shareholder bis zu 5% machen kann. Bertold
Huber hatte sogar gehofft, für die Zustimmung zum neuen Vertrag zwischen VW und Porsche
eine 10%ige Beteiligung zu bekommen.
Gewerkschaften garantieren Marktwirtschaft
Unter dem Druck der Krise zeichnet sich hier eine Positionsänderung zwischen dem neuen
und dem alten IGM-Vorsitzenden ab. Jürgen Peters hatte diese Konzepte noch mit dem
Argument abgelehnt, die Arbeitnehmer könnten nicht noch zu ihren Risiken als
abhängig Beschäftige das Kapitalrisiko übernehmen. Warum er diese Risiken heute
anders bewertet, erklärte der jetzige IG-Metall-Vorsitzende Berthold Huber in einem
Interview mit der FAZ am 23.August. Huber berichtete, viele Unternehmen würden sich mit
der Bitte an die Gewerkschaft wenden, ihnen über die krisenbedingten
Liquiditätsengpässe zu helfen. Für den Fall des Gelingens böten die
Firmeninhaber Beteiligungen an. Huber sieht darin die Chance zu einer Revitalisierung der
Sozialpartnerschaft, die die Gewerkschaft als Verhandlungspartner stärken und eine
Stabilisierung der Ökonomie durch Abwendung vom Shareholder-Value-Regime möglich
machen soll.
 Dabei versuchte er wiederholt,
die Ängste der Herren auf der Kapitalseite zu zerstreuen, er wolle die bewährten
Machtstrukturen zugunsten der Lohnarbeiter verschieben. Es gehe ihm nicht abstrakt um Macht,
schon gar nicht der Gewerkschaft, sondern um die Stabilisierung der Arbeitsplätze.
Keineswegs verfolge er ein neues jugoslawisches Modell von Mitarbeiterkapitalisten oder einen
neuen dritten Weg. Diese Wege seien alle gescheitert. Er stehe zur klaren Rollenverteilung von
Arbeitgeber, Betriebsrat und Gewerkschaft. Die Gewerkschaft wolle auch nicht Unternehmer
werden. „Sie brauchen keine Angst haben vor dem Untergang der Marktwirtschaft, da kann
ich Sie beruhigen.” Und, als wolle er die Anschlussfähigkeit der Gewerkschaften
für chauvinistische Krisenpakte demonstrieren: „Wir brauchen ein Gegengewicht gegen
den Angriff der angelsächsischen Investoren auf deutsche Unternehmen.” Bertold
Huber will die „durch den Turbokapitalismus zerstörte Balance” der
Sozialpartner wiederherstellen. Wodurch? „Wir wollen, dass die Belegschaft zum
Ankeraktionär wird... Unser Ziel als Ankerinvestor ist ein Wechsel in ökologische
Themen, die Verteidigung der technologischen Spitzenposition in Deutschland. Und wir wollen,
dass die Leute fair beteiligt werden.” Kurzum, so heißt es am Schluss des
Interviews: „Wir schaffen Miteigentümer."
Dabei versuchte er wiederholt,
die Ängste der Herren auf der Kapitalseite zu zerstreuen, er wolle die bewährten
Machtstrukturen zugunsten der Lohnarbeiter verschieben. Es gehe ihm nicht abstrakt um Macht,
schon gar nicht der Gewerkschaft, sondern um die Stabilisierung der Arbeitsplätze.
Keineswegs verfolge er ein neues jugoslawisches Modell von Mitarbeiterkapitalisten oder einen
neuen dritten Weg. Diese Wege seien alle gescheitert. Er stehe zur klaren Rollenverteilung von
Arbeitgeber, Betriebsrat und Gewerkschaft. Die Gewerkschaft wolle auch nicht Unternehmer
werden. „Sie brauchen keine Angst haben vor dem Untergang der Marktwirtschaft, da kann
ich Sie beruhigen.” Und, als wolle er die Anschlussfähigkeit der Gewerkschaften
für chauvinistische Krisenpakte demonstrieren: „Wir brauchen ein Gegengewicht gegen
den Angriff der angelsächsischen Investoren auf deutsche Unternehmen.” Bertold
Huber will die „durch den Turbokapitalismus zerstörte Balance” der
Sozialpartner wiederherstellen. Wodurch? „Wir wollen, dass die Belegschaft zum
Ankeraktionär wird... Unser Ziel als Ankerinvestor ist ein Wechsel in ökologische
Themen, die Verteidigung der technologischen Spitzenposition in Deutschland. Und wir wollen,
dass die Leute fair beteiligt werden.” Kurzum, so heißt es am Schluss des
Interviews: „Wir schaffen Miteigentümer."
 Diese Miteigentümer haben
mit ihren kleinen Schachteln natürlich kein Mitspracherecht in der Geschäftspolitik,
sondern bleiben dies eher im Geiste, was erklärt, dass hier auch viel Nebel produziert
werden muss, um dem Phantom eine höhere Weihe zu verleiten. In einem Artikel der IG
Metall ist von einem „richtigen Schritt in eine verantwortungsbewusste
Unternehmenskultur” die Rede. Der IG-BCE-Vorsitzende Schmoldt hofft auf die Einrichtung
einer „neuen Vertrauensebene”, und auch der Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft für Partnerschaft in der Wirtschaft hofft, dass dieses Instrument dem
Gedanken einer partnerschaftlichen Unternehmenskultur Impulse geben kann.
Diese Miteigentümer haben
mit ihren kleinen Schachteln natürlich kein Mitspracherecht in der Geschäftspolitik,
sondern bleiben dies eher im Geiste, was erklärt, dass hier auch viel Nebel produziert
werden muss, um dem Phantom eine höhere Weihe zu verleiten. In einem Artikel der IG
Metall ist von einem „richtigen Schritt in eine verantwortungsbewusste
Unternehmenskultur” die Rede. Der IG-BCE-Vorsitzende Schmoldt hofft auf die Einrichtung
einer „neuen Vertrauensebene”, und auch der Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft für Partnerschaft in der Wirtschaft hofft, dass dieses Instrument dem
Gedanken einer partnerschaftlichen Unternehmenskultur Impulse geben kann.
Eine andere Auslegung der Mitbestimmung
Angesichts dieser Sehnsuchtsbezeugungen nach emotionaler Verbundenheit der Sozialpartner
liest sich der Abschnitt „Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen” aus dem 7-
Punkte-Programm der IG Metall gegen die Krise geradezu nüchtern. Gefordert wird hier eine
Veränderung des Mitbestimmungsgesetzes analog zum VW-Gesetz, das eine Zwei-Drittel-
Mehrheit des Aufsichtsrats bei Betriebsverlagerungen verlangt; der Begriff des
Unternehmensinteresses soll dahingehend verändern werden, dass auch das Allgemeinwohl
berücksichtigt wird. Bei Betrieben, die staatliche Unterstützung erhalten, sollen
Betriebsänderungen an die Zustimmung des Betriebsrats geknüpft werden. Diese
Änderungen könnten — wenn auch vorsichtig — einen Beitrag dazu leisten,
„dass die Verfügungsgewalt des Kapitals zurückgedrängt und die
Entscheidungskompetenzen der abhängig Beschäftigten und der Gesellschaft
ausgeweitet” werden, wie IGM-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban in seinem Artikel
Die Mosaik-Linke (Blätter für deutsche und internationale Politik) ausgedrückt
hat.
 Die Durchsetzung solcher Ziele
steht und fällt mit der Fähigkeit der abhängig Beschäftigten, gemeinsam
betriebs- und grenzüberschreitend zu agieren. Dies erfordert die Loslösung von der
Unternehmenslogik der Arbeitgeber, nicht die verstärkte Bindung an sie durch
Beteiligungen, die an den Regeln des Spiels „Überleben oder Untergehen”
nichts ändern. Nur in Abkehr davon sind Auswege aus der Krise denkbar, die aus der Losung
„Wir zahlen nicht für eure Krise” mehr werden lassen als einen frommen
Wunsch.
Die Durchsetzung solcher Ziele
steht und fällt mit der Fähigkeit der abhängig Beschäftigten, gemeinsam
betriebs- und grenzüberschreitend zu agieren. Dies erfordert die Loslösung von der
Unternehmenslogik der Arbeitgeber, nicht die verstärkte Bindung an sie durch
Beteiligungen, die an den Regeln des Spiels „Überleben oder Untergehen”
nichts ändern. Nur in Abkehr davon sind Auswege aus der Krise denkbar, die aus der Losung
„Wir zahlen nicht für eure Krise” mehr werden lassen als einen frommen
Wunsch.
 Es ist die Vermeidung von
gewerkschaftlichen Anstrengungen in dieser Richtung, die den Widerstand gegen die
Abwälzung der Krisenlasten und eine Offensive für erweiterte Rechte der
Arbeiterklasse so perspektivlos machen — und darüberhinaus so anfällig
für reaktionäre Krisenlösungen. Die Politik der europäischen
Metallgewerkschaften gegenüber den Schließungsabsichten des GM-Konzerns in Europa
ist dafür ein gutes Beispiel. Der Schulterschluss der IG Metall mit den
Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer und mit der Bundesregierung
funktionierte medienwirksam. Doch die Herstellung einer belastungsfähigen Einheit der
europäischen Gewerkschaften ist gescheitert. Die IG Metall setzt auf den Magna-Konzern
und die Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen. Unvermeidbar wird es damit
Werksschließungen in Antwerpen und Zaragoza geben. Auch die Strategie des „Share
the Pain” (Teile die Last) ist zusammengebrochen. Völlig unbeachtet bleibt, dass
die einbezogene EU-Kommission überhaupt nicht daran denkt, den Erhalt von Standorten und
die Anzahl der zu erhaltenden Arbeitsplätze vertraglich festschreiben zu lassen. Am
Schluss bleiben geplatzte Illusionen und gegenseitiges Misstrauen. Das Drehbuch dafür
haben andere geschrieben.
Es ist die Vermeidung von
gewerkschaftlichen Anstrengungen in dieser Richtung, die den Widerstand gegen die
Abwälzung der Krisenlasten und eine Offensive für erweiterte Rechte der
Arbeiterklasse so perspektivlos machen — und darüberhinaus so anfällig
für reaktionäre Krisenlösungen. Die Politik der europäischen
Metallgewerkschaften gegenüber den Schließungsabsichten des GM-Konzerns in Europa
ist dafür ein gutes Beispiel. Der Schulterschluss der IG Metall mit den
Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer und mit der Bundesregierung
funktionierte medienwirksam. Doch die Herstellung einer belastungsfähigen Einheit der
europäischen Gewerkschaften ist gescheitert. Die IG Metall setzt auf den Magna-Konzern
und die Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen. Unvermeidbar wird es damit
Werksschließungen in Antwerpen und Zaragoza geben. Auch die Strategie des „Share
the Pain” (Teile die Last) ist zusammengebrochen. Völlig unbeachtet bleibt, dass
die einbezogene EU-Kommission überhaupt nicht daran denkt, den Erhalt von Standorten und
die Anzahl der zu erhaltenden Arbeitsplätze vertraglich festschreiben zu lassen. Am
Schluss bleiben geplatzte Illusionen und gegenseitiges Misstrauen. Das Drehbuch dafür
haben andere geschrieben.
Ich möchte die SoZ mal in der Hand halten
und bestelle eine kostenlose Probeausgabe oder ein Probeabo
|
|

|
|
Sozialistische Hefte
für Theorie und Praxis
Sonderausgabe der SoZ
42 Seiten, 5 Euro,
|
|
|
Der Stand der Dinge
Perry Anderson überblickt den westpolitischen Stand der Dinge
Gregory Albo untersucht den anhaltenden politischen Erfolg des Neoliberalismus und die Schwäche der Linken
Alfredo Saa-Fidho verdeutlicht die Unterschiede der keynsianischen und der marxistischen Kritik des Neoliberalismus
Ulrich Duchrow fragt nach den psychischen Mechanismen und Kosten des Neoliberlismus
Walter Benn Michaelis sieht in Barack Obama das neue Pin-Up des Neoliberalismus und zeigt, dass es nicht reicht, nur von Vielfalt zu reden
Christoph Jünke über Karl Liebknechts Aktualität
|
|

 Sehr wenig spricht dafür,
dass die aktuelle Wirtschaftskrise ihren Zenit bereits überschritten hat und eine
Trendwende zu erneutem Wirtschaftswachstum bevorsteht. Noch weniger dafür, dass sich die
Situation auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten entspannt. Wir stehen vor
Massenentlassungen und schweren Angriffen auf den Lebensstandard und die materielle Existenz
der Lohnabhängigen. Nicht nur die Partei des Herrn Westerwelle demonstriert mit ihren
aberwitzigen Steuersenkungsforderungen und Vorschlägen zur Verschärfung von Hartz
IV, wen die Vermögensbesitzer dazu auserkoren haben, die jährlichen 100 Milliarden,
die im Staatshaushalt fehlen werden, durch mehr und schlechter bezahlte Arbeit und durch
Verzicht aufzubringen; auch der Finanzminister sagt „harte Verteilungskämpfe”
voraus. Angesichts dieser Aussichten fragt man sich, wie dies mit der Debatte um die
Mitarbeiterbeteiligung zu vereinbaren ist, die vor allem auf den Wirtschaftsseiten der
besseren Zeitungen geführt wird.
Sehr wenig spricht dafür,
dass die aktuelle Wirtschaftskrise ihren Zenit bereits überschritten hat und eine
Trendwende zu erneutem Wirtschaftswachstum bevorsteht. Noch weniger dafür, dass sich die
Situation auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten entspannt. Wir stehen vor
Massenentlassungen und schweren Angriffen auf den Lebensstandard und die materielle Existenz
der Lohnabhängigen. Nicht nur die Partei des Herrn Westerwelle demonstriert mit ihren
aberwitzigen Steuersenkungsforderungen und Vorschlägen zur Verschärfung von Hartz
IV, wen die Vermögensbesitzer dazu auserkoren haben, die jährlichen 100 Milliarden,
die im Staatshaushalt fehlen werden, durch mehr und schlechter bezahlte Arbeit und durch
Verzicht aufzubringen; auch der Finanzminister sagt „harte Verteilungskämpfe”
voraus. Angesichts dieser Aussichten fragt man sich, wie dies mit der Debatte um die
Mitarbeiterbeteiligung zu vereinbaren ist, die vor allem auf den Wirtschaftsseiten der
besseren Zeitungen geführt wird.
 Das Thema selbst ist nicht
neu. Seit den 50er Jahren kommt es wellenförmig immer wieder auf, mit wechselnden
Etiketten. Ein frühes Beispiel für die Propagierung dieser Art
„Volkskapitalismus” war der „Investivlohn”, den auch der
antikommunistische Vorsitzende der IG Bergbau und Energie, Georg Leber, befürwortete und
dabei auf heftigen Widerspruch des damaligen IGM-Vorsitzenden Otto Brenner stieß, der die
Mitbestimmung noch zum Hebel für die Überwindung des Kapitalismus ausbauen wollte.
Später wurde das sog. „624-Mark-Gesetz” als „Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand” eingeführt. Doch auch diese Reform konnte die grundsätzliche
Abhängigkeit der Lohnarbeiter nicht mindern. Das zusätzliche
„Zwangssparen” wurde gerne mitgenommen und diente in der Regel größeren
Anschaffungen.
Das Thema selbst ist nicht
neu. Seit den 50er Jahren kommt es wellenförmig immer wieder auf, mit wechselnden
Etiketten. Ein frühes Beispiel für die Propagierung dieser Art
„Volkskapitalismus” war der „Investivlohn”, den auch der
antikommunistische Vorsitzende der IG Bergbau und Energie, Georg Leber, befürwortete und
dabei auf heftigen Widerspruch des damaligen IGM-Vorsitzenden Otto Brenner stieß, der die
Mitbestimmung noch zum Hebel für die Überwindung des Kapitalismus ausbauen wollte.
Später wurde das sog. „624-Mark-Gesetz” als „Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand” eingeführt. Doch auch diese Reform konnte die grundsätzliche
Abhängigkeit der Lohnarbeiter nicht mindern. Das zusätzliche
„Zwangssparen” wurde gerne mitgenommen und diente in der Regel größeren
Anschaffungen.
 Unabhängig von dieser
gesetzlichen Regelung, auf die alle Beschäftigten einen Anspruch hatten, gab und gibt es
diverse Formen von Mitarbeiterbeteiligung auf betrieblicher Ebene, die jedoch in weniger als
10% der Betriebe gewährt wird. Verhaltensrelevante Summen werden nur in einigen der
großen DAX-Firmen gezahlt. Die Beschäftigten können eine bestimmte Anzahl von
Aktien zum Vorzugspreis kaufen, erhalten darauf Dividenden und profitieren gegebenenfalls von
der Kurssteigerung. Um das Interesse am Erfolg des Unternehmens, das sie beschäftigt,
für Beschäftigte kleinerer Betriebe zu fördern und die Liquidität des
Unternehmens zu verbessern, hat die derzeitige Große Koalition nun ein Gesetz gemacht,
das den Betrag, den der Mitarbeiter steuerfrei in der Firma investieren kann, von 72 auf 400
Euro erhöht und dafür die Einkommensgrenzen heraufgesetzt. Klar ist: Hier wird kein
großes Rad gedreht.
Unabhängig von dieser
gesetzlichen Regelung, auf die alle Beschäftigten einen Anspruch hatten, gab und gibt es
diverse Formen von Mitarbeiterbeteiligung auf betrieblicher Ebene, die jedoch in weniger als
10% der Betriebe gewährt wird. Verhaltensrelevante Summen werden nur in einigen der
großen DAX-Firmen gezahlt. Die Beschäftigten können eine bestimmte Anzahl von
Aktien zum Vorzugspreis kaufen, erhalten darauf Dividenden und profitieren gegebenenfalls von
der Kurssteigerung. Um das Interesse am Erfolg des Unternehmens, das sie beschäftigt,
für Beschäftigte kleinerer Betriebe zu fördern und die Liquidität des
Unternehmens zu verbessern, hat die derzeitige Große Koalition nun ein Gesetz gemacht,
das den Betrag, den der Mitarbeiter steuerfrei in der Firma investieren kann, von 72 auf 400
Euro erhöht und dafür die Einkommensgrenzen heraufgesetzt. Klar ist: Hier wird kein
großes Rad gedreht.
 Bringt die gegenwärtige
Debatte dazu etwas Neues? Neu scheinen die Positionen zu sein, die vom IG-Metall-Vorstand in
die Diskussion gebracht und teilweise bereits realisiert werden. Die IG Metall
befürwortet Mitarbeiterbeteiligung nicht als individuellen Einstieg des Arbeitnehmers in
die betriebliche Vermögensbildung, sondern als kollektive Beteiligung der Belegschaft am
Betriebseigentum. Im Rahmen der Adam Opel AG wurde eine Mitarbeiterbeteiligungs-AG
gegründet, in die Lohnbestandteile und Forderungen der Belegschaft im Wert von 1,5 Mrd.
Euro eingebracht werden. Der Euro-BR-Vorsitzende Klaus Franz kann sich eine 10%ige Beteiligung
am Firmenkapital vorstellen. Auch bei Daimler arbeiten Geschäftsleitung und Betriebsrat
an einem Modell, das erlaubt, Lohnbestandteile einzubehalten. So wird über die
Nichtauszahlung der Erfolgsprämie 2008 ein Betrag von 1900 Euro je Mitarbeiter zu einer
Kapitalbeteiligung. Bei Schaeffler haben BR und IGM einen Deal eingefädelt, der
Lohnsteigerungen von 250 Mio. Euro pro Jahr in Unternehmensbeteiligungen verwandelt, was einem
Anteil von etwa 4% am Firmenkapital entspricht. Auch bei VW ist eine Mitarbeiterbeteiligung in
dieser Form vorgesehen, die die Belegschaft zum Shareholder bis zu 5% machen kann. Bertold
Huber hatte sogar gehofft, für die Zustimmung zum neuen Vertrag zwischen VW und Porsche
eine 10%ige Beteiligung zu bekommen.
Bringt die gegenwärtige
Debatte dazu etwas Neues? Neu scheinen die Positionen zu sein, die vom IG-Metall-Vorstand in
die Diskussion gebracht und teilweise bereits realisiert werden. Die IG Metall
befürwortet Mitarbeiterbeteiligung nicht als individuellen Einstieg des Arbeitnehmers in
die betriebliche Vermögensbildung, sondern als kollektive Beteiligung der Belegschaft am
Betriebseigentum. Im Rahmen der Adam Opel AG wurde eine Mitarbeiterbeteiligungs-AG
gegründet, in die Lohnbestandteile und Forderungen der Belegschaft im Wert von 1,5 Mrd.
Euro eingebracht werden. Der Euro-BR-Vorsitzende Klaus Franz kann sich eine 10%ige Beteiligung
am Firmenkapital vorstellen. Auch bei Daimler arbeiten Geschäftsleitung und Betriebsrat
an einem Modell, das erlaubt, Lohnbestandteile einzubehalten. So wird über die
Nichtauszahlung der Erfolgsprämie 2008 ein Betrag von 1900 Euro je Mitarbeiter zu einer
Kapitalbeteiligung. Bei Schaeffler haben BR und IGM einen Deal eingefädelt, der
Lohnsteigerungen von 250 Mio. Euro pro Jahr in Unternehmensbeteiligungen verwandelt, was einem
Anteil von etwa 4% am Firmenkapital entspricht. Auch bei VW ist eine Mitarbeiterbeteiligung in
dieser Form vorgesehen, die die Belegschaft zum Shareholder bis zu 5% machen kann. Bertold
Huber hatte sogar gehofft, für die Zustimmung zum neuen Vertrag zwischen VW und Porsche
eine 10%ige Beteiligung zu bekommen.
